
An dieser Stelle möchte ich einen weiteren Auszug aus meinem 2-bändigen Buch „Zwischen Hybris & Angst: Die Kriese des modernen Ich“ veröffentlichen. Das Thema ist vielschichtig und bedarf der Betrachtung diverser Blickrichtungen und Blickwinkel. Auch wenn ich nicht den Anspruch der Vollständigkeit oder gar Endgültigkeit erhebe, ist es mir womöglich gelungen, die Aufmerksamkeit auf einzelne Problematiken der Gegenwart zu wecken und ein Bewusstsein hierfür zu kreieren. In Band 1 gehe ich auf die individuellen Faktoren der Themen ein. Während sich Band 2 mit den gesellschaftlichen Einflüssen und Faktoren auseinandersetzt. Ich hoffe ich kann Ihre Neugier anregen und freue mich auf Diskussionen, Meinungen und Vorschläge. Vergessen wir nicht: Demokratischer Wandel ist nur durch einen freien, offenen Austausch von Meinungen möglich und wir bräuchten ihn jetzt dringend.
Die siebzehnjährige Maya starrt auf ihr Smartphone-Display, während sie in der überfüllten U-Bahn sitzt. Um sie herum herrscht das vertraute Schweigen der digitalen Ära – Dutzende von Menschen, jeder in seine eigene virtuelle Welt versunken. Ihre Finger fliegen über den Bildschirm, zwischen Instagram-Stories, TikTok-Videos und WhatsApp-Nachrichten wechselnd. In wenigen Minuten hat sie mehr Informationen konsumiert als ihre Großeltern in einer ganzen Woche. Doch als sie das Handy wegsteckt und aus dem Fenster blickt, hat die die Mehrheit dieser Informationen bereits wieder vergessen.
Maya ist kein Einzelfall. Sie repräsentiert eine ganze Generation, die zwischen zwei Polen gefangen zu sein scheint: der Hybris der unbegrenzten Möglichkeiten und der lähmenden Angst vor einer ungewissen Zukunft. Es ist eine Generation, die mit mehr Wissen und Werkzeugen ausgestattet ist als jede vor ihr, die aber gleichzeitig von Selbstzweifeln, Depressionen und einer tiefen existenziellen Verunsicherung geplagt wird. Die Frage, die sich Eltern, Pädagogen und Gesellschaftsforscher stellen müssen, ist nicht mehr nur, wie wir unsere Kinder und Jugendlichen fördern können, sondern ob wir sie vielleicht bereits verloren haben.
Diese Betrachtung führt uns in das Herz einer gesellschaftlichen Transformation, die weit über technologische Neuerungen hinausgeht. Wir erleben nicht nur einen Wandel der Kommunikationsmittel oder der Arbeitsweisen, sondern eine fundamentale Neuordnung der menschlichen Erfahrung selbst. Die Art, wie junge Menschen heute ihre Identität konstruieren, Beziehungen eingehen und ihre Zukunft planen, unterscheidet sich radikal von den Mustern früherer Generationen. Diese Veränderung ist so tiefgreifend, dass sie philosophische Grundfragen über das Wesen des Menschseins, die Natur der Gemeinschaft und die Bedeutung des individuellen Lebens aufwirft.
Um zu verstehen, was mit unserer Jugend geschieht, müssen wir zunächst das gesellschaftliche Gefüge analysieren, in dem sie aufwächst. Es ist ein Gefüge, das von paradoxen Kräften geprägt ist. Einerseits leben wir in einer Zeit beispielloser Möglichkeiten: Nie war Bildung zugänglicher, nie waren die Werkzeuge zur Selbstverwirklichung vielfältiger, nie schienen die Grenzen des Machbaren durchlässiger. Gleichzeitig erleben wir eine Ära der Fragmentierung, der Unsicherheit und der beschleunigten Veränderung, die traditionelle Orientierungspunkte obsolet macht und so auch neue Formen der Angst hervorbringt.
Die gesellschaftlichen Faktoren, die diese Entwicklung vorantreiben, sind vielschichtig und miteinander verwoben. Sie reichen von den offensichtlichen technologischen Umbrüchen über subtile Verschiebungen in den Familienstrukturen bis hin zu den tieferliegenden philosophischen Krisen unserer Zeit. Jeder dieser Faktoren wirkt nicht isoliert, sondern in einem komplexen Zusammenspiel, das neue Realitäten schafft und alte Gewissheiten auflöst.
Die technologische Revolution, die wir erleben, ist mehr als nur die Einführung neuer Geräte oder Anwendungen. Sie stellt eine anthropologische Wende dar, die die Grundlagen menschlicher Existenz berührt. Wenn ein Jugendlicher heute durchschnittlich sieben Stunden täglich mit digitalen Medien verbringt, dann verändert das nicht nur seinen Tagesablauf, sondern seine gesamte Wahrnehmung von Zeit, Raum und sozialer Realität. Die Unterscheidung zwischen virtueller und physischer Welt wird zunehmend irrelevant, nicht weil die Grenzen verschwimmen, sondern weil sich eine neue, hybride Realität etabliert, in der beide Sphären untrennbar miteinander verknüpft sind.
Diese hybride Realität bringt neue Formen der Identitätsbildung mit sich. Während frühere Generationen ihre Persönlichkeit primär durch direkte soziale Interaktionen und die Auseinandersetzung mit der physischen Umwelt entwickelten, konstruieren heutige Jugendliche ihre Identität zu einem erheblichen Teil durch ihre digitale Präsenz. Das Selbstbild wird nicht mehr nur durch Spiegelungen in den Augen anderer Menschen geformt, sondern durch Likes, Kommentare und die algorithmische Aufmerksamkeitsökonomie sozialer Medien. Diese neue Form der Identitätsarbeit ist gleichzeitig befreiend und bedrängend. Sie ermöglicht eine beispiellose Selbstgestaltung und Kreativität, setzt aber auch einen permanenten Druck zu Selbstoptimierung und Selbstvermarktung in Gang.
Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die psychische Gesundheit junger Menschen sind dramatisch. Studien aus verschiedenen Ländern zeigen einen kontinuierlichen Anstieg von Depressionen, Angststörungen und Selbstverletzungen bei Kindern und Jugendlichen. Besonders beunruhigend ist, dass dieser Trend nicht nur die ohnehin vulnerablen Gruppen betrifft, sondern sich durch alle sozialen Schichten zieht. Selbst Jugendliche aus privilegierten Verhältnissen, die alle materiellen und bildungsbezogenen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben mitbringen, zeigen zunehmend Symptome psychischer Belastung.
Die Paradoxie dieser Situation wird deutlich, wenn man bedenkt, dass objektiv betrachtet die Lebensumstände junger Menschen in vielen Bereichen besser sind als je zuvor. Die Bildungschancen sind gestiegen, die materielle Versorgung ist in den wohlhabenden Gesellschaften gesichert, die Toleranz für individuelle Lebensentwürfe hat zugenommen. Dennoch oder gerade deswegen erleben viele Jugendliche ihr Leben als überfordernd und sinnentleert. Diese Diskrepanz zwischen objektiven Lebensumständen und subjektivem Wohlbefinden deutet auf tieferliegende strukturelle Probleme hin, die über individuelle Schwächen oder temporäre Anpassungsschwierigkeiten hinausgehen.
Ein zentraler gesellschaftlicher Faktor, der diese Entwicklung vorantreibt, ist die Auflösung traditioneller Strukturen und Autoritäten. Institutionen, die früher Orientierung und Sicherheit boten – Familie, Schule, Kirche, Vereine – haben an Bindekraft verloren oder ihre Funktion grundlegend verändert. Diese Entwicklung ist nicht per se negativ; aber sie hat autoritäre und leitende Strukturen aufgebrochen und individuelle Freiheiten erweitert. Vielleicht hat sie gerade deshalb einen Orientierungsverlust zur Folge, der besonders junge Menschen betrifft, die noch dabei sind, ihre eigenen Wertesysteme zu entwickeln.
Die moderne Familie exemplifiziert diesen Wandel besonders deutlich. Während die patriarchalischen Familienstrukturen der Vergangenheit durchaus Nachteile mit sich brachten, boten sie doch einen klaren Rahmen und vorhersagbare Rollenverteilungen. Die heutige Familie ist flexibler, individueller aber auch fragiler geworden und unbeständiger. Kinder wachsen häufig in komplexen Patchwork-Konstellationen auf, erleben Trennungen und Neuorientierungen ihrer Eltern und müssen schon früh lernen, mit Unsicherheit und Veränderung umzugehen. Gleichzeitig werden sie paradoxerweise oft überbehütet und vor allen möglichen Gefahren abgeschirmt, was ihre Fähigkeit zur selbstständigen Bewältigung von Herausforderungen einschränkt.
Diese Überbehütung ist selbst Ausdruck einer gesellschaftlichen Angst, die sich auf die nächste Generation überträgt. Eltern, die selbst in einer Welt der Unsicherheit leben, projizieren ihre Ängste auf ihre Kinder und versuchen gleichzeitig, sie vor allen möglichen Risiken zu schützen. Das Resultat ist eine Generation junger Menschen, die einerseits früh mit den Komplexitäten des Erwachsenenlebens konfrontiert wird, andererseits aber wenig Gelegenheit hatte, eigene Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Sie sind informiert über alle möglichen Gefahren und Probleme dieser Welt, aber oft nicht darauf vorbereitet, produktiv mit diesen Herausforderungen umzugehen.
Das Bildungssystem spiegelt und verstärkt diese Widersprüche. Einerseits wurde es in den letzten Jahrzehnten demokratisiert und individualisiert. Mehr Kinder haben Zugang zu höherer Bildung, die Lernmethoden sind vielfältiger geworden, und individuelle Begabungen werden stärker berücksichtigt. Andererseits steht das Bildungssystem unter einem enormen Leistungsdruck, der sich aus den Anforderungen einer wissensbasierten Wirtschaft und dem internationalen Wettbewerb ergibt. Schüler erleben Schule zunehmend als Leistungsmaschine, in der es primär darum geht, messbare Ergebnisse zu erzielen und sich für den nächsten Selektionsschritt zu qualifizieren. Dabei erscheint einigen absurd noch zu lernen, wenn doch alles Wissen der Welt jederzeit auf Abruf zur Verfügung steht.
Diese Ökonomisierung der Bildung hat weitreichende Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Lernen wird nicht mehr als intrinsisch wertvolle Tätigkeit erfahren, sondern als Mittel zum Zweck der Karriereoptimierung. Das führt zu einer instrumentellen Haltung gegenüber Wissen und Fähigkeiten, die die Freude am Entdecken und Verstehen untergräbt. Gleichzeitig erzeugt der permanente Bewertungsdruck eine Kultur der Angst vor dem Scheitern, die Kreativität und Risikobereitschaft hemmt. Jugendliche lernen früh, dass Fehler nicht als natürlicher Teil des Lernprozesses akzeptiert werden, sondern als Defizite, die die eigenen Zukunftschancen gefährden.
Die Arbeitsmarktperspektiven, die sich jungen Menschen heute bieten, verstärken diese Unsicherheit zusätzlich. Die Vorstellung einer linearen Berufsbiographie, in der man eine Ausbildung absolviert und dann bis zur Rente in demselben Beruf arbeitet, ist obsolet geworden. Stattdessen müssen sich junge Menschen auf eine Zukunft einstellen, in der lebenslanges Lernen, berufliche Neuorientierungen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse die Norm sind. Diese Flexibilitätsanforderungen werden oft als Chance zur Selbstverwirklichung gepriesen, aber sie bedeuten auch, dass traditionelle Sicherheiten wegfallen und jeder Einzelne die Verantwortung für seine Laufbahn trägt.
Die ständige Verfügbarkeit von Informationen über das Internet schafft paradoxerweise nicht mehr Wissen, sondern bei fehlendem eigenen Wissen mehr Verwirrung. Während frühere Generationen sich ihre Informationen aus wenigen, aber relativ vertrauenswürdigen Quellen beschafften, sehen sich heutige Jugendliche einer unüberschaubaren Flut von Informationen, Meinungen und Behauptungen gegenüber, deren Wahrheitsgehalt oft schwer zu beurteilen ist. Die Fähigkeit zur Quellenkritik und zur Bewertung von Informationen kann mit der Geschwindigkeit der Informationsproduktion nicht Schritt halten. Das Resultat ist eine epistemische Verunsicherung, die sich in Form von Verschwörungstheorien, wissenschaftsfeindlichen Haltungen oder einem generellen Zynismus gegenüber etablierten Wissensformen äußern kann.
Gleichzeitig verstärkt die mögliche globale Perspektive das Gefühl der Ohnmacht. Während frühere Generationen ihre politische Wirksamkeit primär im lokalen oder nationalen Rahmen erfahren konnten, sehen sich heutige Jugendliche Problemen gegenüber, die globale Koordination und langfristige Strategien erfordern. Die Diskrepanz zwischen dem Bewusstsein für die vorgebliche Dringlichkeit der Probleme und der eigenen Einflussmöglichkeit kann zu Resignation oder radikalen politischen Haltungen führen. Manche Jugendliche ziehen sich völlig aus dem politischen Geschehen zurück, andere wenden sich extremistischen Bewegungen zu, die einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen.
Die Beschleunigung des gesellschaftlichen Wandels macht es auch schwierig, von einer Generation zur nächsten Orientierung zu vermitteln. Die Lebenserfahrungen der Eltern- und Großelterngeneration erscheinen irrelevant für die Herausforderungen, mit denen sich junge Menschen heute konfrontiert sehen. Technologische Entwicklungen, gesellschaftliche Veränderungen und wirtschaftliche Umbrüche vollziehen sich so schnell, dass bewährte Strategien und Weisheiten ihre Gültigkeit verlieren, bevor sie weitergegeben werden können. Diese Entwertung intergenerational übertragenen Wissens verstärkt das Gefühl der Isolation und Orientierungslosigkeit bei jungen Menschen.
Die Urbanisierung und Mobilität moderner Gesellschaften tragen ebenfalls zur Fragmentierung sozialer Beziehungen bei. Während Menschen früher oft ihr ganzes Leben in derselben Gemeinschaft verbrachten und dadurch stabile soziale Netzwerke aufbauen konnten, sind heutige Biografien von Umzügen, Schulwechseln und beruflichen Neuorientierungen geprägt. Diese Mobilität eröffnet neue Chancen und Erfahrungen, aber sie erschwert auch die Entwicklung tiefer und dauerhafter Beziehungen. Junge Menschen müssen immer wieder neue soziale Kontakte knüpfen und sich an veränderte Umgebungen anpassen, was emotional belastend sein kann.
Die Kommerzialisierung der Kindheit und Jugend ist ein weiterer Faktor, der die Entwicklung junger Menschen beeinflusst. Kinder und Jugendliche sind heute nicht mehr nur Objekte elterlicher Fürsorge und gesellschaftlicher Bildungsbemühungen, sondern auch Zielgruppe einer mächtigen Konsumgüterindustrie. Diese Industrie investiert erhebliche Ressourcen in die Erforschung jugendlicher Wünsche und Bedürfnisse, nicht um diese zu befriedigen, sondern um sie zu instrumentalisieren und zu verstärken. Die Botschaften der Werbeindustrie prägen die Vorstellungen junger Menschen über ein gelungenes Leben, über Erfolg, Schönheit und Glück. Sie schaffen künstliche Bedürfnisse und unrealistische Erwartungen, die zu permanenter Unzufriedenheit führen können.
Besonders problematisch ist dabei die Sexualisierung der Kindheit. Schon sehr junge Menschen werden mit sexualisierten Bildern und Botschaften konfrontiert, die ihre Vorstellungen über Körperlichkeit, Beziehungen und Selbstwert nur selten positiv prägen. Die Pornografie-Industrie, die über das Internet leicht zugänglich ist, vermittelt verzerrte Bilder von Sexualität und zwischenmenschlichen Beziehungen. Junge Menschen, die ihre ersten Erfahrungen mit Sexualität oft über diese Medien machen, entwickeln unrealistische Erwartungen und problematische Haltungen, die ihre Fähigkeit zu gesunden Beziehungen beeinträchtigen können.
Die Auflösung traditioneller Geschlechterrollen bringt auch neue Verwirrungen mit sich. Während frühere Generationen klare, wenn auch eingeschränkte Vorstellungen davon hatten, was es bedeutet, ein Mann oder eine Frau zu sein, müssen heutige Jugendliche ihre Geschlechtsidentität in einem Umfeld konstruieren, in dem die Grenzen zwischen den Geschlechtern vorgeblich fließend werden. Diese Flexibilität kann zu Identitätsunsicherheit führen, besonders in einer Entwicklungsphase, in der die Persönlichkeit noch nicht gefestigt ist.
Die Arbeitswelt, auf die sich junge Menschen vorbereiten, ist von zunehmender Prekarität geprägt. Die klassischen Vollzeitbeschäftigungen mit lebenslanger Jobsicherheit werden seltener, während befristete Verträge, Gig-Economy und Solo-Selbstständigkeit zunehmen. Diese Entwicklung wird oft als Flexibilisierung des Arbeitsmarktes gepriesen, aber sie bedeutet auch, dass junge Menschen ein hohes Maß an Unsicherheit in ihre Lebensplanung einkalkulieren müssen. Die Aussicht auf eine unsichere berufliche Zukunft beeinflusst fundamentale Lebensentscheidungen: Wann kann man eine Familie gründen? Wie kann man für das Alter vorsorgen? Lohnt es sich, langfristige Verpflichtungen einzugehen?
…
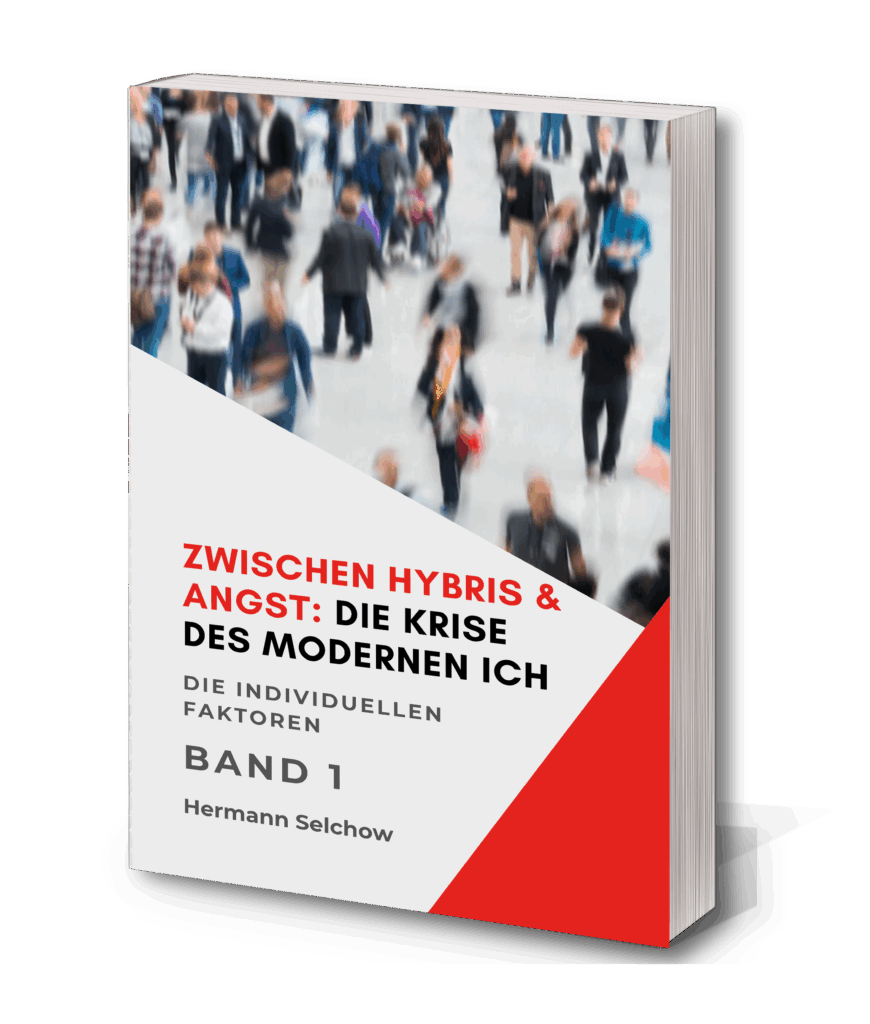
Zwischen Hybris & Angst – Die Krise des modernen Ich
Wer sind wir – wenn Anstand, Moral und Mitgefühl verschwinden?
Unsere Zeit ist geprägt von Gegensätzen: grenzenloser Selbstentfaltung auf der einen Seite – lähmender Angst, Orientierungslosigkeit und einem stillen Werteverfall auf der anderen. In einer Welt voller Selbstinszenierung, Narzissmus und moralischer Beliebigkeit droht das moderne Ich zu zerbrechen.
Dieses Buch soll ein Weckruf sein. Mit klarem Blick und tiefem Gespür für gesellschaftliche und seelische Entwicklungen zeigt es, wie wir uns als Menschen und als Gemeinschaft verlieren – und warum eine Rückbesinnung auf humanistische Werte heute dringender ist denn je.
Ein Buch für alle, die spüren: So wie es ist, darf es nicht bleiben.