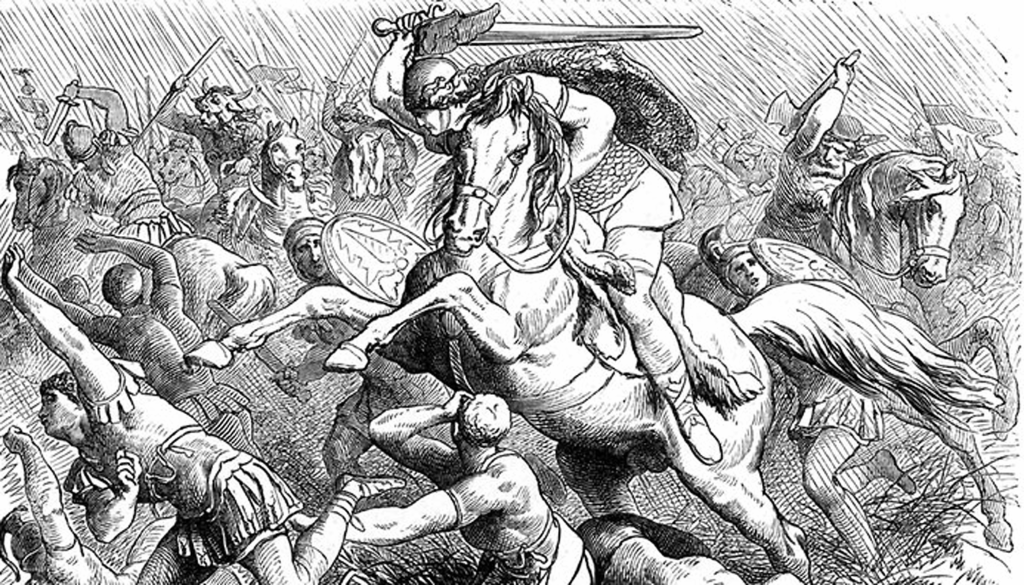
In meinem neuen Buch „Die Erben der Legenden – Deutsche Mythen im Spiegel der Gegenwart“ befasse ich mich mit der Bedeutung unserer Mythen, Legenden und Sagen. Offensichtlich erinnern sich Menschen in Zeiten von Unruhe, Chaos und Unsicherheit immer wieder dieser Erzählungen, die weit mehr sind als bloße Geschichten. Sie enthalten Gemeinschaft, Erklärungsmetaphern und Handlungsanleitungen, die uns aufzeigen können, was zu tun ist, wie und warum. Hier eine Leseprobe:
Aus dem Vorwort:
Die Beschäftigung mit Mythen eröffnet einen Zugang zur tiefenpsychologischen und kulturellen Dimension des Menschseins. Sie zeigt, dass wir als moderne Menschen nicht so weit entfernt sind von unseren Vorfahren, wie wir oft glauben. In den Erzählungen von Prometheus, der den Göttern das Feuer stiehlt, oder von Ikarus, der an seinem Übermut scheitert, spiegeln sich Erfahrungen, die uns bis heute prägen: der Wunsch nach Erkenntnis, die Angst vor Strafe, die Sehnsucht nach Freiheit, die Gefahr der Hybris. Mythen erzählen von den Schattenseiten und den Möglichkeiten des Menschseins – und sie tun dies in einer Bildsprache, die sich rationaler Argumentation oft entzieht, dafür aber unmittelbar wirkt.
Indem wir uns den Mythen zuwenden, begegnen wir nicht nur fremden Welten, sondern auch uns selbst. Ihre Bilder und Motive sind Teil unseres kollektiven Unbewussten, sie formen unsere Träume, Ängste und Sehnsüchte. Wer die alten Geschichten erzählt, erzählt immer auch von den Fragen und Konflikten seiner eigenen Zeit. In diesem Sinne sind Mythen nie wirklich vergangen. Sie leben fort, verändern sich, passen sich an, tauchen in neuen Formen und Medien auf. Ihre Überlebensfähigkeit verdanken sie ihrer Vielschichtigkeit und ihrer Fähigkeit, existenzielle Themen in erzählerische Bilder zu fassen.
Dieses Vorwort versteht sich als Einladung zu einer Reise in die Welt der Mythen. Es will dazu ermutigen, die alten Geschichten nicht als überholte Kuriositäten abzutun, sondern sie als lebendige Zeugnisse menschlicher Existenz ernst zu nehmen. Ziel ist es, zu zeigen, dass die mythische Erzählweise ein universales Phänomen ist, das in unterschiedlichen Kulturen und Zeiten ähnlich funktioniert – und dass es auch in der scheinbar so rationalen Gegenwart einen festen Platz hat.
In der Gegenwart schwinden alte Gewissheiten und die Welt wird immer komplexer. Doch auch heute noch können Mythen Orientierung bieten. Nicht, weil sie einfache Antworten liefern, sondern weil sie die ewigen Fragen stellen und Räume für Deutung eröffnen. Sie erinnern daran, dass der Mensch nicht nur ein rationales, sondern auch ein erzählendes Wesen ist, das seine Welt in Geschichten ordnet und Sinn stiftet. Dieses Vorwort will einen Beitrag dazu leisten, den Mythos als kulturelles Grundmuster zu begreifen und seine Bedeutung für die Gegenwart herauszustellen.
„Die Erben der Legenden – Deutsche Mythen im Spiegel der Gegenwart“
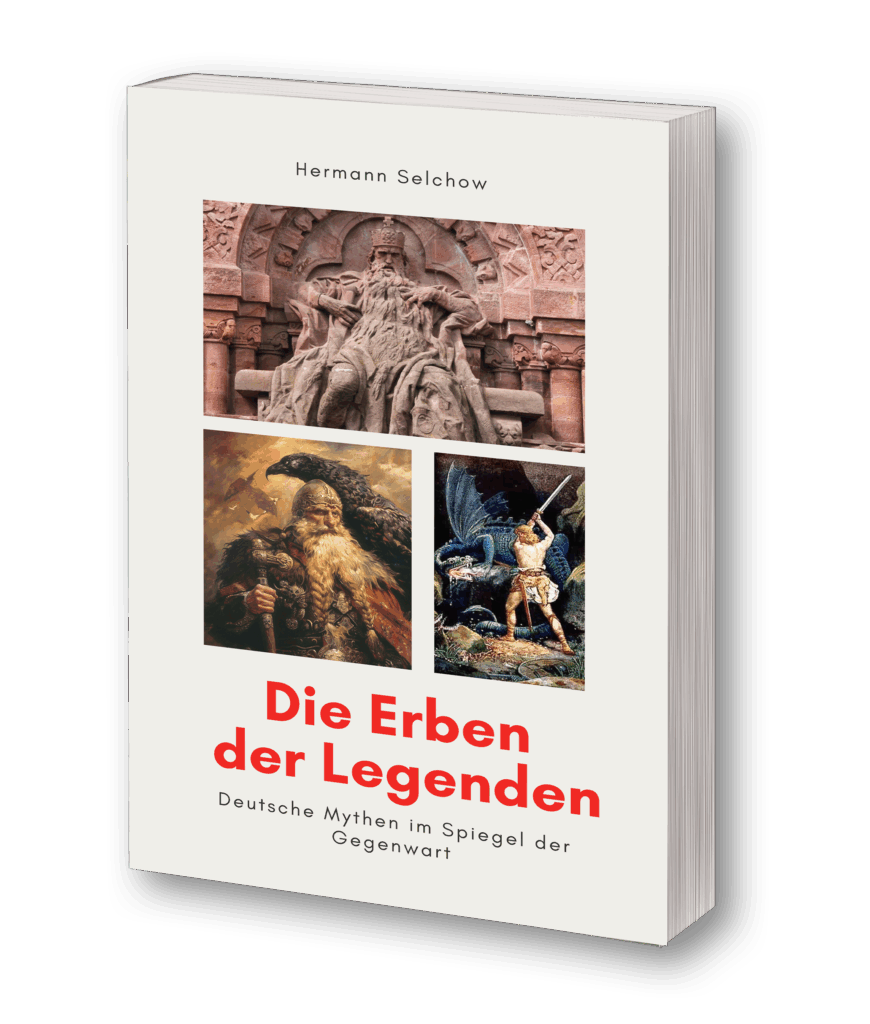

Über das Buch:
Welche Bedeutung haben die alten Mythen unserer Vorfahren heutzutage und was haben sie mit den Herausforderungen der Gegenwart zu tun? Weitaus mehr, als viele glauben. In allen Zeiten, in denen gesellschaftliche und politische Unsicherheiten zunehmen oder technologische Entwicklungen unsere Welt rasant verändern, rücken die alten Geschichten wieder ins Bewusstsein. Dieses Buch zeigt eindrucksvoll, dass Mythen weit mehr sind als romantische Erzählungen aus vergangenen Jahrhunderten. Sie sind verschlüsselte Handlungsanleitungen für Krisenzeiten — und wer sie richtig liest, entdeckt darin Strategien für Mut, Verantwortung und Wandel.
Der Autor verbindet fundiertes kulturgeschichtliches Wissen mit moderner Analyse und macht deutlich: Die alten Erzählungen von Walhall, Siegfried oder den Göttern der Edda sind nicht nur kulturelles Erbe, sondern praktische Lebenshilfe in unruhigen Zeiten. Sie erinnern uns daran, dass es der Einzelne ist, der Entscheidungen trifft, wenn die Gemeinschaft zu zaudern beginnt. Sie zeigen, wie man aus Chaos Ordnung schafft und warum das Vergessen dieser Geschichten eine Gefahr für jede Gesellschaft ist.
Dieses Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Mythen, Geschichte und kulturelles Gedächtnis interessieren — und an all jene, die in der Gegenwart nach Orientierung suchen. Wer erfahren möchte, warum unsere alten Geschichten nicht nur überliefert, sondern verstanden und genutzt werden sollten, findet hier Inspiration, Denkanstöße und konkrete Handlungsimpulse.
Dieses Buch erscheint voraussichtlich Mitte Mai diesen Jahren in deutsch und englisch in Ihrer Online-Buchhandlung.
Mythen als Chance: Erinnerung und Verantwortung
Wenn wir von (unseren) Mythen sprechen, verfallen wir schnell in ein dualistisches Denken. Entweder erscheinen sie als Relikte einer vergangenen, von Aberglauben und archaischer Weltsicht bestimmten Epoche, oder sie werden verklärt zu poetischen Erzählungen, die uns einen symbolischen Zugang zu uralten Menschheitsthemen eröffnen. In beiden Fällen bleibt ihr eigentlicher Wert für das kulturelle Gedächtnis und für die Verantwortung einer Gesellschaft gegenüber ihrer eigenen Geschichte oft unbeachtet. Dabei sind Mythen weit mehr als Geschichten, sie sind kollektive Speicher von Erfahrungen, Warnungen und Hoffnungen. Sie bündeln das Wissen und die Emotionen ganzer Generationen und Kulturen, die durch ihre Überlieferung über die Jahrhunderte hinweg einen Dialog mit der Gegenwart führen.
Die westliche Moderne hat in ihrem Bestreben, alles Rationale zu messen und alles Irrationale zu verbannen, einen Großteil dieses überlieferten Erbes als irrationales Beiwerk abgetan. Was einst als elementarer Bestandteil kollektiver Identität diente, wurde entweder in die Literatur verwiesen, in musealen Kontexten verwahrt oder im schlimmsten Fall mit ideologischen Deutungen überformt und instrumentalisiert. Der Preis dieser Entwicklung war hoch: Denn ohne ein Bewusstsein für die symbolischen Erzählungen einer Kultur, ohne ein aktives kulturelles Gedächtnis, verliert eine Gesellschaft die Fähigkeit, sich in Krisenzeiten zu orientieren, sich selbst zu spiegeln und aus alten Fehlern zu lernen.
Mythen sind nicht bloß Erzählungen über Götter und Helden. Sie sind narrative Landkarten, die über Generationen hinweg aufzeichnen, wie eine Gesellschaft ihr Verhältnis zu Welt, Schicksal und Moral verstand. Sie verhandeln zentrale Fragen menschlichen Daseins: Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was schulden wir einander? Welche Regeln gelten für das Zusammenleben? Welche Kräfte wirken jenseits unserer Kontrolle? Indem Mythen Antworten auf diese Fragen geben – oft metaphorisch, manchmal widersprüchlich, nie endgültig – schaffen sie Orientierung. Sie formulieren eine kulturelle Grammatik, an der sich Werte, Haltungen und Erwartungen bemessen lassen.
Das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft ist nicht statisch, sondern ein sich wandelndes Gefüge aus Erinnerungen, Erzählungen und Deutungen. Es bestimmt, welche Geschichten erzählt, welche verschwiegen und welche vergessen werden. Mythen sind darin wie Fixpunkte, an denen sich Erinnerung immer wieder neu ausrichtet. In ihnen verdichten sich kollektive Erfahrungen von Krieg und Frieden, von Schuld und Erlösung, von Aufstieg und Untergang. Sie speichern Konflikte und Kompromisse, Überzeugungen und Tabus. Indem eine Gesellschaft entscheidet, welche Mythen sie bewahrt, aktualisiert oder verwirft, entscheidet sie auch, wie sie sich selbst versteht und welche Verantwortung sie gegenüber Vergangenheit und Zukunft übernehmen will.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte der Nibelungen. Sie erzählt nicht nur von Treue, Verrat und tödlichem Ehrgeiz, sondern spiegelt auch das Verhältnis einer Gesellschaft zu Loyalität und individueller Verantwortung. Über Jahrhunderte hinweg diente das Nibelungenlied als moralische Richtschnur, als warnendes Beispiel und als Legitimationsquelle für politische Entscheidungen. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde diese Überlieferung unterschiedlich gedeutet, je nach ideologischem und politischem Bedarf. Doch der Text selbst blieb in seiner Vieldeutigkeit erhalten. Er konnte sowohl als Lob der Treue wie als Mahnung vor unreflektierter Pflichterfüllung gelesen werden.
Gerade in dieser Ambivalenz liegt die Chance von Mythen für eine moderne Gesellschaft. Sie sind keine starren Dogmen, sondern dynamische Erzählungen, die immer wieder neu ausgelegt und auf die Gegenwart bezogen werden können. Sie fordern die Gesellschaft heraus, sich mit ihrem kulturellen Erbe auseinanderzusetzen, ohne sich ihm kritiklos zu unterwerfen. Mythen bieten die Möglichkeit, sich der eigenen Wurzeln zu vergewissern, ohne in rückwärtsgewandte Idealisierung zu verfallen. Sie können als Spiegel dienen, in dem eine Gemeinschaft ihre Werte überprüft und hinterfragt.
In einer Zeit, in der Globalisierung und digitale Beschleunigung traditionelle kulturelle Bindungen auflösen und Identitätsmuster fluid werden, könnten Mythen dazu beitragen, den gesellschaftlichen Diskurs zu erden. Nicht im Sinne von rigider Tradition oder nationaler Abgrenzung, sondern als geteilte narrative Bezugspunkte, die über Generationen hinweg Orientierung und Identifikation stiften. Sie können helfen, das kulturelle Gedächtnis lebendig zu halten und kollektive Verantwortung für das Erbe der Vergangenheit zu übernehmen.
Dazu gehört auch, sich den dunklen Kapiteln der eigenen Mythengeschichte zu stellen. Mythen wurden immer auch missbraucht: zur Legitimation von Macht, zur Ausgrenzung von Fremden, zur ideologischen Verbrämung politischer Gewalt. Eine verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit Mythen bedeutet deshalb, diese Vereinnahmungen zu erkennen und kritisch zu reflektieren. Die Frage ist nicht, ob Mythen gefährlich sind, sondern wie eine Gesellschaft mit diesem Erbe umgeht. Ob sie es verdrängt oder integriert, ob sie seine destruktiven Potenziale verleugnet oder aus ihnen lernt.
Ein reflektierter Umgang mit Mythen eröffnet die Chance, vergangene Erfahrungen und Fehler produktiv zu erinnern und daraus Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Denn Mythen handeln immer auch von möglichen Wegen und Entscheidungen. Sie zeigen, dass es alternative Deutungen von Welt und Gesellschaft gibt, dass Geschichte nicht zwangsläufig verläuft, sondern gestaltbar ist. Mythen können dazu beitragen, kulturelle Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, tradierte Rollenbilder zu überprüfen und gesellschaftliche Visionen zu entwerfen.
In einer fragmentierten und von Unsicherheiten geprägten Gegenwart, in der viele Sinnstiftungsinstanzen erodieren, könnten Mythen wieder zu kollektiven Ressourcenträgern werden. Sie laden dazu ein, über Ängste und Verantwortung, über individuelle Freiheit und gemeinschaftliche Pflichten, über das Verhältnis zu Natur und Technik, über Endlichkeit und Hoffnung nachzudenken. Mythen bewahren in ihren Erzählstrukturen oft anthropologische Konstanten, die auch in einer sich wandelnden Gesellschaft Bedeutung behalten.
Wenn Gesellschaften es schaffen, ihre Mythen nicht zu verdrängen, sondern sich ihrer Komplexität und Ambivalenz zu stellen, bewahren sie sich ein kulturelles Gedächtnis, das mehr ist als Archiv oder Folklore. Sie erhalten sich ein kritisches Bewusstsein für die eigenen kulturellen Prägungen und Handlungsmuster. Daraus erwächst kollektive Verantwortung: für die Gestaltung der Gegenwart, für den Umgang mit dem kulturellen Erbe und für die Zukunft der Gemeinschaft.
Die Chance der Mythen liegt genau darin: Sie sind nie nur Geschichten von gestern, sondern immer auch Fragen an das Heute. Wer sie vergisst oder verdrängt, verliert einen Teil seiner kulturellen Handlungsfähigkeit. Wer sie klug nutzt, kann aus ihnen Orientierung und Kraft gewinnen, ohne sich von ihnen beherrschen zu lassen. In diesem Sinne sind Mythen weniger Monumente der Vergangenheit als Impulse für die Zukunft.
In der Geschichte waren es immer wieder einzelne Persönlichkeiten, die durch ihr außergewöhnliches Handeln, ihren Mut und ihre Bereitschaft, gegen den Strom ihrer Zeit zu agieren, aus der anonymen Masse heraustraten und zu lebenden oder posthumen Mythen wurden. Diese Gestalten wurden nicht nur durch ihre Taten bedeutend, sondern auch durch die Geschichten, die man sich über sie erzählte – Geschichten, die oft über Generationen hinweg tradiert, überhöht und sinnbildlich aufgeladen wurden. Sie verkörperten Eigenschaften, nach denen sich Gemeinschaften in Zeiten der Unsicherheit sehnten: Entschlossenheit, Mut, Treue, Opferbereitschaft und den Willen, für eine größere Sache einzustehen.
Ein prägnantes Beispiel ist Arminius, der Cheruskerfürst, der im Jahr 9 nach Christus die römischen Legionen unter Varus im Teutoburger Wald vernichtend schlug. Historisch betrachtet war dies ein bedeutender militärischer Erfolg, der den römischen Vorstoß in das Gebiet östlich des Rheins auf Dauer stoppte. Doch weit über den realen Schlachtverlauf hinaus wuchs Arminius über die Jahrhunderte zu einer Symbolfigur des germanischen Widerstands gegen äußere Unterdrückung. Besonders im 19. Jahrhundert wurde er von der nationalen Bewegung vereinnahmt und zu einem mythischen Helden verklärt. Seine Tat wurde als Beweis für den Freiheitswillen und die Unbeugsamkeit des „deutschen Volkes“ interpretiert, obwohl es ein solches in ethnisch-nationaler Geschlossenheit zu jener Zeit noch gar nicht gab. Das Hermannsdenkmal bei Detmold, errichtet zwischen 1838 und 1875, ist Ausdruck dieser nationalen Mythenbildung und der Wunschprojektion nach einem einigenden Helden, der das zersplitterte Deutschland gegen äußere Mächte verteidigt.
…
Was alle diese Figuren verbindet, ist, dass sie in existenziellen Krisenzeiten auftraten und durch außergewöhnliche Taten oder Haltungen eine Leitfigur für ein kollektives Bedürfnis nach Ordnung, Sinn und Identität wurden. Ihre Taten wurden mythisch überhöht, ihre Schwächen ausgeblendet, ihre Geschichten moralisch aufgeladen. In ihrer jeweiligen Zeit dienten sie nicht nur der Legitimation von Herrschaft oder politischen Zielen, sondern auch der Erschaffung eines kulturellen Narrativs, das den Menschen Orientierung bot.
Gerade in Perioden gesellschaftlicher Umbrüche, wenn vertraute Strukturen ins Wanken geraten und neue Bedrohungen auftreten, gewinnen solche Persönlichkeiten eine Bedeutung, die über das Historische hinausgeht. Sie erfüllen eine psychologische Funktion: Sie verkörpern jene Werte und Haltungen, nach denen sich eine verunsicherte Gesellschaft sehnt, und liefern den Beweis, dass das scheinbar Unmögliche möglich ist, wenn jemand bereit ist, sich über die Norm zu erheben.
Die Mythenbildung um Arminius, Blücher, Luise von Preußen und Bismarck zeigt exemplarisch, wie aus historischen Persönlichkeiten nationale Sinnbilder werden können. In ihnen kulminierten die Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte ihrer Zeit, und sie wurden zu Vehikeln eines kulturellen Gedächtnisses, das bis in die Gegenwart wirkt. Ihre Geschichten sind nicht nur Erinnerungen an Vergangenes, sondern Erzählungen, die bis heute politische und gesellschaftliche Diskurse prägen. Das macht sie zu mehr als bloßen historischen Figuren – es macht sie zu mythischen Stellvertretern kollektiver Identität.
Was die historischen Figuren zu Mythen werden ließ, war nicht allein ihr Rang, ihre Herkunft oder ihre Stellung, sondern der Umstand, dass sie in Momenten der Unsicherheit und des Umbruchs bereit waren, eine Entscheidung zu treffen, die gegen den bequemen Strom der Zeit schwamm. Sie standen in entscheidenden Situationen auf, übernahmen Verantwortung und handelten, wo andere zauderten. Das Bemerkenswerte daran ist: Diese Fähigkeit liegt grundsätzlich in jedem Menschen. Die Überhöhung einzelner Gestalten zu Heroen und Leitfiguren hat uns über Jahrhunderte glauben lassen, dass es besonderer Abstammung, göttlicher Gunst oder außergewöhnlicher Begabung bedarf, um in entscheidenden Momenten Großes zu bewirken. Doch diese Annahme ist ein Erbe jener Mythen selbst – und zugleich eine Einladung, den eigenen Einfluss zu unterschätzen.
In Wahrheit ist jeder Einzelne Träger von Möglichkeiten, die sich oft erst im Angesicht von Krisen, Konflikten oder Herausforderungen zeigen. Chaos und Unsicherheit haben historisch nicht nur Systeme destabilisiert, sondern auch Räume geschaffen, in denen Menschen über sich hinauswuchsen. Es ist jener berühmte Moment der Entscheidung, der darüber bestimmt, ob ein Einzelner sich in die Menge zurückzieht oder aufsteht. Geschichte zeigt, dass Wandel fast immer von Einzelnen angestoßen wurde, deren Mut und Konsequenz andere mitriss oder zwang, Stellung zu beziehen.
Das bedeutet nicht, dass jeder sofort zum Staatslenker, Heerführer oder ideellen Märtyrer werden muss. Vielmehr beginnt verantwortliches Handeln oft im Kleinen: in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Diskurs. Wer in Zeiten der Unsicherheit Klarheit zeigt, wer Haltung wahrt, wo Opportunismus lockt, wer widerspricht, wo Anpassung bequemer wäre, setzt Signale. Solche Gesten, Worte oder Entscheidungen mögen auf den ersten Blick unbedeutend wirken, doch sie summieren sich in ihrer Wirkung.
…
In Zeiten des gesellschaftlichen, politischen oder moralischen Chaos ist es also nicht nur möglich, sondern geradezu notwendig, dass Einzelne den Mut aufbringen, Orientierung zu geben und konsequent zu handeln. Dies verlangt keine perfekten Lösungen und keine makellosen Heldenfiguren, sondern den entschlossenen Willen, für etwas einzustehen, das über das eigene Wohl hinausweist. Das kann ein Grundsatz, eine Idee oder eine Haltung sein, die dem Gemeinwesen in unsicheren Zeiten Halt gibt.
Wenn mehr Menschen bereit sind, sich dieser Verantwortung zu stellen, ohne auf einen äußeren Erlöser oder die „große Gestalt“ zu warten, beginnt Wandel. Nicht durch spontane Revolution, sondern durch eine wachsende Zahl von Einzelnen, die ihre eigene Rolle erkennen und ausfüllen. Die alten Mythen haben, bei aller Überhöhung, immer wieder diese Botschaft vermittelt: Der Einzelne ist nicht machtlos. Er trägt in sich die Möglichkeit, den Lauf der Dinge zu beeinflussen – sei es durch Wort, Tat oder das bloße Standhalten in Momenten, wo andere weichen.
…