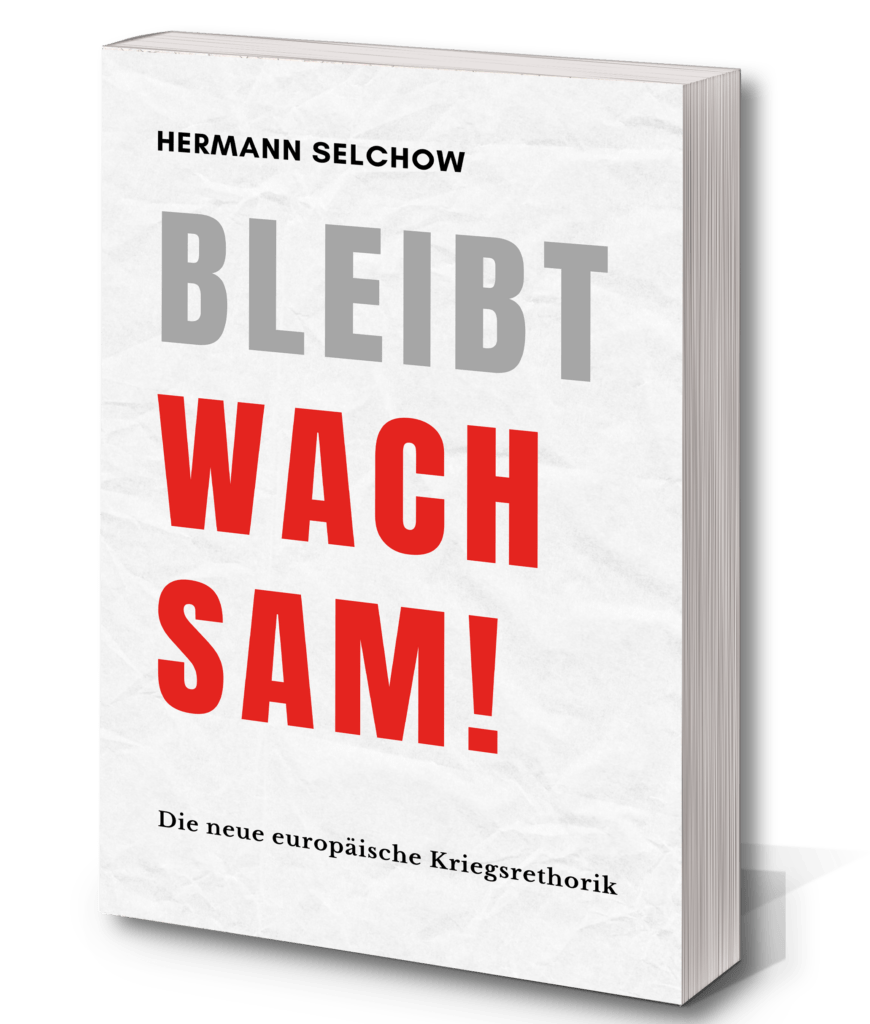
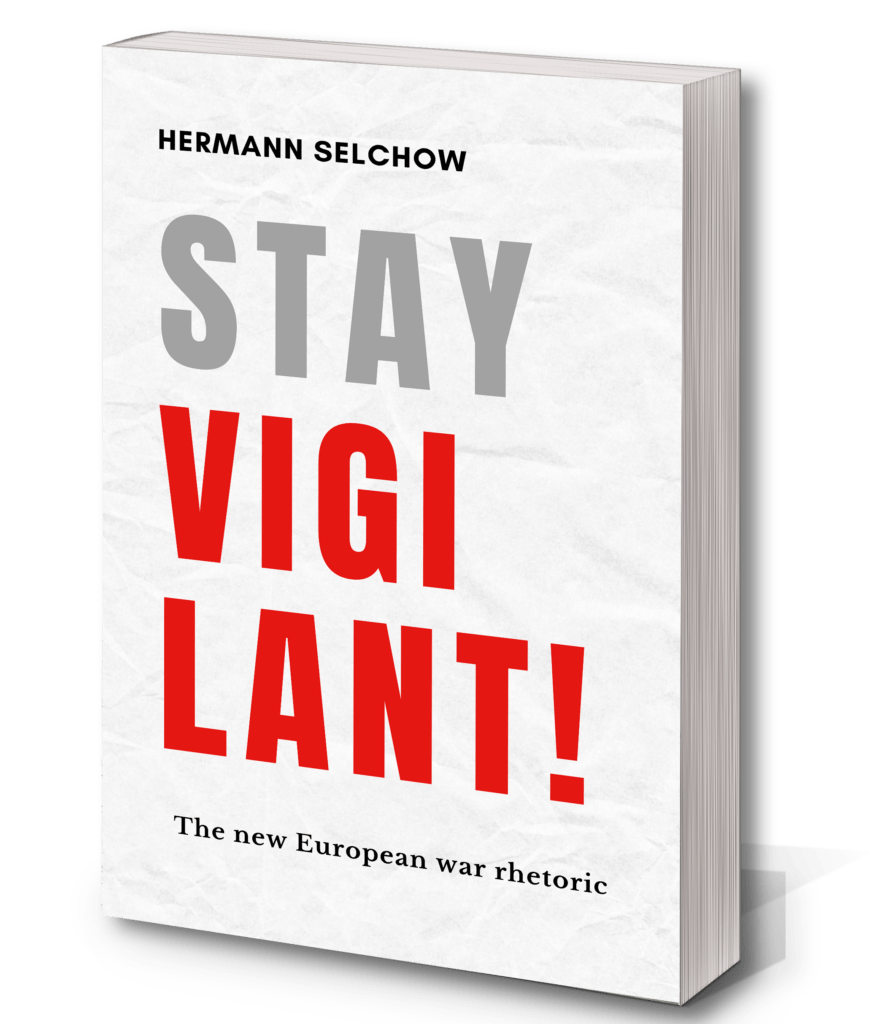
Bleibt wachsam! – Die neue Kriegsrhetorik in Europa
Wie Feindbilder entstehen, wer davon profitiert – und wie wir den Weg zum Frieden erhalten können
In einer Zeit geopolitischer Spannungen und medialer Dauerkrisen dominiert eine gefährliche Sprache unsere politische Landschaft: Kriegsrhetorik. Doch wie entstehen diese Narrative? Wer konstruiert Feindbilder – und aus welchem Interesse heraus? „Bleibt wachsam!“ nimmt Sie mit auf eine fundierte, schonungslose Analyse der gegenwärtigen politischen Kommunikation in Europa und deckt auf, welche wirtschaftlichen und strategischen Kräfte hinter dem aggressiven Kurs der EU stehen.
- Wer sind die eigentlichen Profiteure der Kriegsrhetorik?
- Welche Rolle spielen Medien, Wirtschaft und transatlantische Netzwerke?
- Wie beeinflussen Angst und Propaganda unsere Wahrnehmung?
- Warum sind manche Menschen anfälliger für diese Narrative als andere?
- Welche Alternativen gibt es für eine friedlichere, diplomatische Zukunft?
Dieses Buch verbindet politikwissenschaftliche Analyse mit spannendem Storytelling und zeigt nicht nur die Mechanismen hinter der aktuellen Eskalationsrhetorik, sondern bietet auch Lösungen an: Wie kann Europa zurück zu einer Politik des Dialogs, der Diplomatie und der Kooperation finden? Und welche Rolle können wir als Bürger dabei spielen?
Für alle, die die Welt hinter den Schlagzeilen verstehen und sich nicht von einfachen Feindbildern leiten lassen wollen.
Jetzt lesen und mitreden – denn Frieden beginnt mit Wissen!
Ein Auszug:
Europa hat sich lange Zeit gerühmt bezüglich seiner friedlichen Integration und der Überwindung historischer Feindseligkeiten. Doch ein genauer Blick auf gegenwärtige politische Debatten, Medienberichterstattung und außenpolitische Strategien offenbart wieder eine tief verwurzelte Kriegsrhetorik, die trotz diplomatischer Fassade wieder entsteht. Dieser Sprachgebrauch dient nicht nur der Rechtfertigung militärischer Interventionen, sondern beeinflusst auch das öffentliche Bewusstsein und prägt das Bild von „Freunden“ und „Feinden“.
Während des Kalten Krieges dominierten Begriffe wie „Eiserner Vorhang“ und „kommunistische Bedrohung“ die westliche Wahrnehmung. Nach dem Fall der Berliner Mauer hätte man erwarten können, dass Europa eine lange Ära friedlicher Rhetorik einläutet. Doch stattdessen wandelten sich die Narrative lediglich – von der Angst vor dem Kommunismus zur Bedrohung durch Terrorismus, Russlands oder anderer geopolitische Rivalen. Die Sprache wurde wieder kriegerisch, wenn auch subtiler und mit modernen Begriffen verschleiert.
Die Medien spielen dabei eine zentrale Rolle. Berichterstattung über Konflikte ist selten neutral – sie folgt oft einer vorgegebenen Agenda, die bestimmte Akteure als Aggressoren oder Verteidiger darstellt. Begriffe wie „humanitäre Intervention“, „präventive Verteidigung“ oder „Stabilisierungseinsätze“ sind Euphemismen, die militärische Aktionen harmloser erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind.
Politiker nutzen seit einigen Jahren gezielt Sprache, um Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung zu erzeugen. Feindbilder werden konstruiert oder aufgebauscht, indem Staaten oder politische Bewegungen als existenzielle Bedrohung dargestellt werden. So wird die öffentliche Meinung in eine Richtung gelenkt, die militärische Maßnahmen legitimieren sollen.
Die Sprache des Krieges hat sich zunehmend wieder in unseren Alltag eingeschlichen. Formulierungen wie „Verteidigungsbereitschaft stärken“, „Kriegsfähigkeit“, „strategische Autonomie“ und „Abschreckungspotential“ sind nicht mehr auf die Fachliteratur der Sicherheitspolitik beschränkt, sondern haben Einzug in die Morgenlektüre von Millionen Europäern gehalten.
„Bleibt wachsam!“ ist keine Kampfschrift. Es ist auch kein Plädoyer für naiven Pazifismus. Vielmehr versteht sich dieses Buch als ein Weckruf zur kritischen Reflexion über die Art und Weise, wie wir in Europa über Sicherheit, Konflikte und internationale Beziehungen sprechen. Die Sprache, die wir verwenden, ist nicht mehr von Neutralität geprägt. Sie formt unser Denken, beeinflusst unsere Wahrnehmung und bereitet den Boden für politisches Handeln.
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Worte den Waffen oft vorausgehen. Bevor Grenzen mit Panzern überschritten werden, werden sie in den Köpfen neu gezogen. Bevor Bomben fallen, werden Feindbilder konstruiert. Die Rhetorik der Feindseligkeit, der Abgrenzung und der Unvereinbarkeit bereitet den Weg für die Logik des Krieges. Europa, ein Kontinent, der im 20. Jahrhundert die verheerendsten Konflikte der Menschheitsgeschichte erlebt und verursacht hat, entwickelte nach 1945 eine politische Kultur, die auf Ausgleich, Dialog und Integration setzte. Diese Kultur spiegelte sich in einer Sprache wider, die das Gemeinsame betonte und nach Kompromissen suchte.
In den letzten Jahren jedoch beobachten wir eine zunehmende Militarisierung unserer Sprache und unseres Denkens. Dieser Wandel vollzieht sich nicht im luftleeren Raum. Er ist eingebettet in tiefgreifende geopolitische Verschiebungen, in die Erosion internationaler Ordnungsstrukturen, in ein wachsendes Gefühl der Unsicherheit. Die neue Kriegsrhetorik ist ein Symptom dieser Veränderungen – aber sie verstärkt sie auch und kann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden wenn wir nicht alle wachsam bleiben.
Besonders faszinierend ist für mich die historische Dimension der gegenwärtigen Entwicklung in der Welt. Auf der einen Seite sind die Parallelen zu früheren Perioden der europäischen Geschichte frappierend – auf der anderen Seite sind die Unterschiede mindestens ebenso aufschlussreich. Gerade in Deutschland, wo die Erinnerung an zwei Weltkriege tief im kollektiven Gedächtnis verankert ist, vollzieht sich der rhetorische Wandel rascher und offensiver als in anderen Teilen Europas.
Mit diesem Buch geht mir nicht darum, eine bestimmte sicherheitspolitische Position zu propagieren. Vielmehr will ich einen Raum öffnen für eine bewusstere Auseinandersetzung mit unserer Sprache und den Weltbildern, die sie transportiert. Die Leserinnen und Leser dieses Buches werden eingeladen, genauer hinzuhören und hinzusehen – auf die Worte, die von Politikern, Experten und Medien gewählt werden, aber auch auf die eigenen sprachlichen Gewohnheiten.
Die folgenden Kapitel bieten einen Blick auf die sich öffnenden Landschaften der europäischen Kriegsrhetorik. Wir werden untersuchen, wie sich die Sprache innerhalb der Europäischen Union verändert hat, welche Rolle die Medien in der Verbreitung und Normalisierung bestimmter Sprachmuster spielen und wie sich die öffentliche Meinung unter dem Einfluss dieser Rhetorik verändert.
Ein besonderes Augenmerk lege ich auf die Narrative und Sprachformen, die es ermöglichen, über Kriegsvorbereitungen zu sprechen, ohne der Logik des Friedenserhalts und Diplomatie zu folgen. Denn es gibt sie: die Sprache der Kooperation, der gemeinsamen Sicherheit, der präventiven Diplomatie. Sie ist keine naive Utopie, sondern hat in der europäischen Geschichte immer wieder praktische Wirksamkeit bewiesen.
Dieses Buch ist entstanden aus einer tiefen Sorge um die Zukunft Europas – aber auch aus der Überzeugung, dass wir als Bürgerinnen und Bürger nicht machtlos sind gegenüber den Strömungen der Zeit. Indem wir uns der Macht der Sprache bewusst werden, gewinnen wir einen Teil dieser Macht zurück. Kritisches Denken beginnt mit kritischem Hören und Lesen.
„Bleibt wachsam!“ ist daher mehr als ein Buchtitel – es ist eine Aufforderung zur intellektuellen Wachsamkeit in Zeiten, in denen das Denken in Schwarz-Weiß-Kategorien wieder an Boden gewinnt. Es ist eine Einladung, der Komplexität der Welt standzuhalten und einfachen Erklärungen zu misstrauen. Und es ist ein Appell, die Sprache als das zu erkennen, was sie ist: nicht nur ein Spiegel der Realität, sondern ein mächtiges aber nicht unüberwindbares Werkzeug zu ihrer Gestaltung.
Ich danke allen, die mich auf dem Weg zu diesem Buch begleitet und unterstützt haben – den Gesprächspartnern, die ihr Wissen mit mir geteilt haben und vor Allem den kritischen Lesern meiner bereits erschienen Bücher. Ein besonderer Dank gilt jenen Stimmen in Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die unermüdlich für eine differenzierte Sicherheitsdebatte eintreten – neuerdings wieder gegen den Strom der Zeit. Möge dieses Buch einen Beitrag leisten zu einer bewussteren, reflektierteren Kommunikation über die großen Herausforderungen unserer Zeit. Denn die Art, wie wir über die Welt sprechen, entscheidet mit darüber, in welcher Welt wir leben werden.
Hermann Selchow