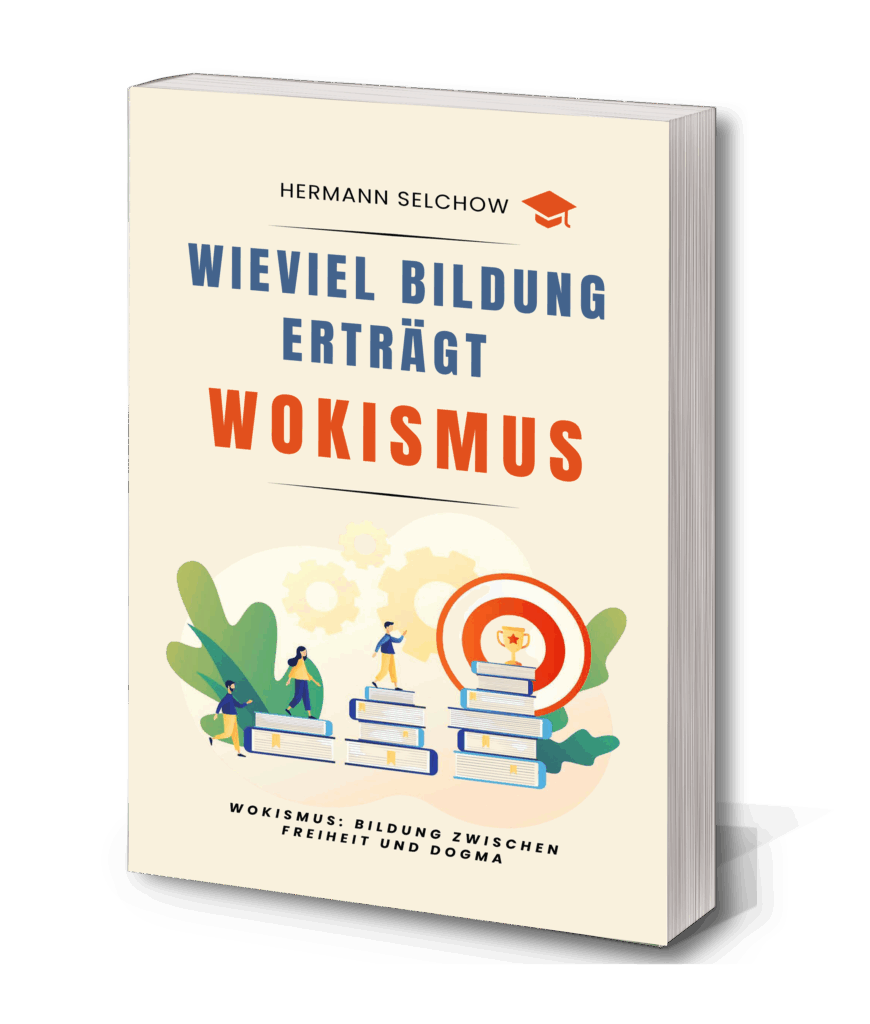
Wieviel Bildung erträgt Wokismus – Essays zu Bildung zwischen Freiheit und Dogma
Ab Montag dem 15.09.2025 erscheint mein neues Buch in den einschlägigen Online-Buchhandlungen – zunächst auf Deutsch (englisch ist derzeit in Bearbeitung).
Das kritische Sachbuch zur aktuellen Bildungskrise
Die deutsche und amerikanische Hochschullandschaft durchlebt gegenwärtig eine Phase tiefgreifender Veränderungen. Während diese Entwicklungen oft unter dem Banner von Fortschritt und sozialer Gerechtigkeit stehen, zeigen sich bei näherer Betrachtung auch problematische Aspekte, die kritische Fragen aufwerfen.
Dieses Buch untersucht systematisch, wie sich die zunehmende Politisierung des Universitätsbetriebs auf Studenten auswirkt, die abweichende Meinungen vertreten oder kritische Fragen stellen. Anhand dokumentierter Fälle aus Deutschland und den USA wird aufgezeigt, welche Mechanismen zur Anwendung kommen, wenn junge Menschen den herrschenden Konsens in Frage stellen.
Ein notwendiger Beitrag zur Bildungsdebatte
Die hier dokumentierten Entwicklungen sind nicht auf einzelne Universitäten oder Länder beschränkt. Sie spiegeln einen internationalen Trend wider, der die Grundlagen der westlichen Bildungstradition betrifft. Das Buch versteht sich als Beitrag zu einer überfälligen gesellschaftlichen Diskussion über die Zukunft der Hochschulbildung.
Besonders wertvoll ist die Darstellung der psychologischen und sozialen Mechanismen, die zur Selbstzensur und Anpassung führen. Leser erhalten ein tieferes Verständnis dafür, warum viele junge Menschen ihre authentischen Überzeugungen aufgeben und sich einem System unterwerfen, das Konformität belohnt und Originalität bestraft.
Ein wichtiger Beitrag zur Zeitdiagnose, der zur Reflexion anregt und zur differenzierten Diskussion über die Zukunft unserer Bildungseinrichtungen einlädt.
Ein Auszug:
In den sterilen Gängen unserer Universitäten wandelt ein Gespenst umher – nicht das des Kommunismus, wie Marx es einst beschwor, sondern das einer neuen Orthodoxie, die sich selbst als progressiv feiert und dabei die Grundlagen dessen zerstört, was Bildung einst bedeutete. Es ist eine seltsame Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet jene Institutionen, die sich der Aufklärung und dem freien Denken verschrieben hatten, heute zu Tempeln einer neuen Glaubenslehre mutiert sind, in denen Häresie nicht mehr durch Scheiterhaufen, sondern durch soziale Ächtung und akademische Exkommunikation bestraft wird.
Die Universität, einst ein Ort des Streits und der intellektuellen Reibung, hat sich in eine Wellness-Oase für empfindsame Seelen verwandelt, in der jede unbequeme Wahrheit als „Mikroaggression“ gebrandmarkt und jeder Widerspruch als „toxisch“ kategorisiert wird. Wo einst Sokrates seine Gesprächspartner durch beharrliches Nachfragen in die Enge trieb, bis sie die Brüchigkeit ihrer Überzeugungen erkannten, herrscht heute die Devise: „Hinterfrage nichts, was die Gefühle verletzen könnte.“ Der sokratische Dialog ist dem therapeutischen Gruppengespräch gewichen, die Dialektik der Empathie-Lyrik.
Man könnte meinen, es handle sich um einen schlechten Scherz der Weltgeschichte: Ausgerechnet die Generation, die sich selbst als die aufgeklärteste aller Zeiten betrachtet, errichtet neue Denkverbote mit einer Effizienz, die jeden mittelalterlichen Inquisitor vor Neid erblassen ließe. Nur dass die heutigen Autodafés nicht auf Marktplätzen stattfinden, sondern in den Echokammern sozialer Medien, wo Reputationen schneller verbrennen als Bücher im Feuer der Bücherverbrenner.
Beginnen wir mit einer Szene aus dem akademischen Alltag: Professor Müller – nennen wir ihn so, obwohl er genauso gut Schmidt oder Weber heißen könnte – betritt seinen Hörsaal zur Vorlesung über europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts. Früher hätte er vielleicht mit einer provokanten These begonnen, einer steilen Behauptung, die seine Studenten zum Widerspruch gereizt hätte. Heute tastet er sich vorsichtig vor wie ein Minensucher im Gedankengefild der politischen Korrektheit. „Liebe Studierende,“ beginnt er und meidet bereits instinktiv das generische Maskulinum, „heute sprechen wir über die Industrialisierung und ihre sozialen Folgen.“ Eine harmlose Einleitung, könnte man meinen. Aber Professor Müller weiß: Jedes Wort kann zur Falle werden.
Denn in der Welt der woken Bildungseinrichtungen ist Geschichte nicht mehr die Erforschung vergangener Ereignisse, sondern ein Instrument zur Durchsetzung gegenwärtiger ideologischer Ziele geworden. Die Vergangenheit wird nicht verstanden, sondern verurteilt – und zwar nach den moralischen Standards einer Zeit, die sich für den Höhepunkt der menschlichen Entwicklung hält. Es ist, als würde man Shakespeare vorwerfen, keine Smartphones verwendet zu haben, oder Aristoteles dafür kritisieren, dass er nicht über Instagram philosophiert hat.
Diese neue Form der Geschichtsbetrachtung folgt einem simplen Muster: Die Vergangenheit wird in ein Morality Play verwandelt, in dem es nur noch Unterdrücker und Unterdrückte gibt, Täter und Opfer, Böse und Gute. Die Komplexität menschlicher Motivationen, die Widersprüche historischer Entwicklungen, die Paradoxien gesellschaftlicher Transformation – all das verschwindet hinter einer binären Weltanschauung, die so grob gestrickt ist wie ein mittelalterlicher Holzschnitt.
Nehmen wir das Beispiel der Aufklärung, jener Epoche, die eigentlich das geistige Fundament unserer Universitäten bildet. Voltaire, Diderot, Kant – alles „alte weiße Männer“, wie sie heute abfällig genannt werden, als wäre dies bereits eine hinreichende Kritik ihrer Gedanken. Dass diese „alten weißen Männer“ die geistigen Grundlagen für die Gleichberechtigung aller Menschen legten, dass sie die Sklaverei kritisierten und für die Menschenrechte kämpften – das wird gerne übersehen. Stattdessen konzentriert man sich auf ihre Widersprüche und Blindheiten, als wären historische Gestalten nur dann akzeptabel, wenn sie bereits die vollständige Moral des 21. Jahrhunderts verkörperten.
Diese retroaktive moralische Erpressung der Geschichte hat fatale Folgen für das Verständnis historischer Entwicklungen. Geschichte wird nicht mehr als komplexer Prozess verstanden, in dem Menschen unter spezifischen Bedingungen handelten, sondern als simpler Kampf zwischen Gut und Böse. Das aber ist das Ende jeder ernstaften Geschichtswissenschaft und der Beginn der Geschichtspropaganda.
Professor Müller weiß das alles, aber er weiß auch, dass ein offener Widerspruch gegen diese neue Orthodoxie karriereschädlich sein kann. Also navigiert er vorsichtig durch die Untiefen der political correctness, fügt hier eine Entschuldigung ein („Selbstverständlich müssen wir die kolonialistische Perspektive dieser Quellen kritisch hinterfragen“), dort eine Relativierung („Es ist wichtig zu betonen, dass marginalisierte Stimmen in dieser Zeit unterrepräsentiert waren“). Seine Vorlesung wird zu einem Tanz auf Eierschalen, bei dem die eigentliche Wissensvermittlung zur Nebensache wird.
Die Studenten merken das natürlich. Sie spüren die Angst ihres Professors, seine Vorsicht, seine permanente Bereitschaft zur Selbstkritik. Und sie lernen daraus eine wichtige Lektion – allerdings nicht die, die eine Universität vermitteln sollte. Sie lernen nicht, kritisch zu denken oder komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Sie lernen, dass es gefährlich ist, unbequeme Fragen zu stellen, und dass intellektuelle Conformität der sicherste Weg zum Erfolg ist.
Das ist vielleicht die bitterste Ironie der woken Bildungsrevolution: Sie produziert genau das Gegenteil dessen, was sie vorgibt zu bekämpfen. Statt kritischer Denker zieht sie Duckmäuser heran, statt mutiger Querdenker ängstliche Mitläufer, statt intellektueller Rebellen gehorsame Ideologen. Die Universität, einst der Ort, an dem junge Menschen lernten, Autoritäten zu hinterfragen, ist selbst zur ultimativen Autorität geworden – nur dass sie ihre Macht nicht durch Argumente, sondern durch emotionale Erpressung ausübt.
Betrachten wir ein weiteres Beispiel aus dem universitären Alltag: die Literaturwissenschaft, einst die Krone der Geisteswissenschaften. Hier sollten Studenten lernen, die großen Werke der Weltliteratur zu verstehen, ihre Sprache zu entschlüsseln, ihre Bedeutungsebenen zu erforschen. Doch was geschieht heute in den Seminaren zu Shakespeare oder Goethe? Die Werke werden nicht mehr gelesen, um sie zu verstehen, sondern um sie zu entlarven. Jeder Text wird zum Kriminalfall, in dem nach Spuren von Sexismus, Rassismus, Klassismus gefahndet wird. Der Text wird nicht mehr als autonomes Kunstwerk betrachtet, sondern als Symptom gesellschaftlicher Machtverhältnisse.
Diese Art der Literaturbetrachtung mag ihre Berechtigung haben – als ein Ansatz unter vielen. Problematisch wird sie, wenn sie zum einzigen Zugang erklärt wird, wenn die Schönheit und Komplexität eines Kunstwerks hinter seiner ideologischen Instrumentalisierung verschwindet. Wenn Studenten lernen, dass „Der Kaufmann von Venedig“ nichts anderes ist als ein antisemitisches Pamphlet, „Der Sturm“ eine kolonialistische Fantasie und „Hamlet“ die Geschichte eines toxischen Patriarchen, dann haben sie etwas Wesentliches über Literatur gelernt: dass sie nur dann wertvoll ist, wenn sie den moralischen Standards der Gegenwart entspricht.
Die Folgen sind absehbar: Studenten verlieren das Interesse an der Literatur vergangener Epochen, weil sie gelernt haben, dass alles, was vor ihrer Zeit geschrieben wurde, moralisch kontaminiert ist. Sie lesen keine Klassiker mehr, weil diese ihnen als Relikte einer verwerflichen Vergangenheit erscheinen. Die großen Werke der Weltliteratur, die über Jahrhunderte hinweg Generationen von Lesern bewegten und prägten, werden zu musealen Objekten, die nur noch unter Quarantäne-Bedingungen betrachtet werden dürfen.
Dabei ist es eine der grundlegenden Erkenntnisse der Bildung, dass wir nur dann verstehen können, wer wir sind, wenn wir wissen, woher wir kommen. Die Vergangenheit – mit all ihren Widersprüchen und Unvollkommenheiten – ist das Material, aus dem unsere Gegenwart geformt ist. Wer sie leugnet oder verteufelt, beraubt sich selbst der Möglichkeit zur Selbsterkenntnis. Er wird zu einem Menschen ohne Geschichte, ohne Wurzeln, ohne Orientierung.
Die woke Ideologie verspricht das Gegenteil: absolute moralische Klarheit in einer komplexen Welt. Sie bietet einfache Antworten auf komplizierte Fragen und eindeutige Schuldzuweisungen für mehrdeutige Situationen. Das macht sie so verführerisch, besonders für junge Menschen, die sich in einer unübersichtlichen Welt zurechtfinden müssen. Die woke Weltanschauung funktioniert wie eine Landkarte: Sie zeigt, wo die guten und wo die bösen Gebiete liegen, welche Wege sicher und welche gefährlich sind.
Das Problem ist nur: Diese Landkarte bildet die Wirklichkeit nicht ab. Sie ist ein ideologisches Konstrukt, das die Komplexität der Welt auf handliche Formeln reduziert. Wer sich nach ihr orientiert, wird nicht ans Ziel gelangen, sondern sich hoffnungslos verirren. Denn die Wirklichkeit ist nun einmal komplizierter als jede Ideologie, mehrdeutiger als jede Moral, widersprüchlicher als jede Weltanschauung.
…