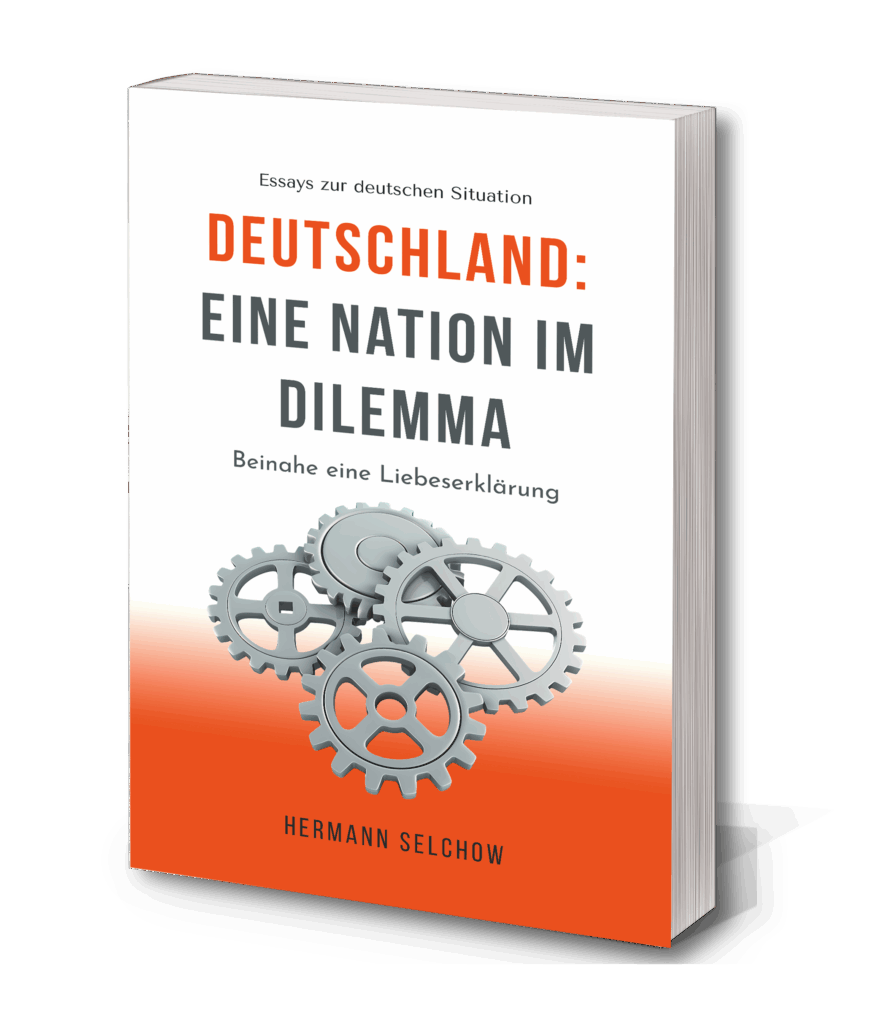
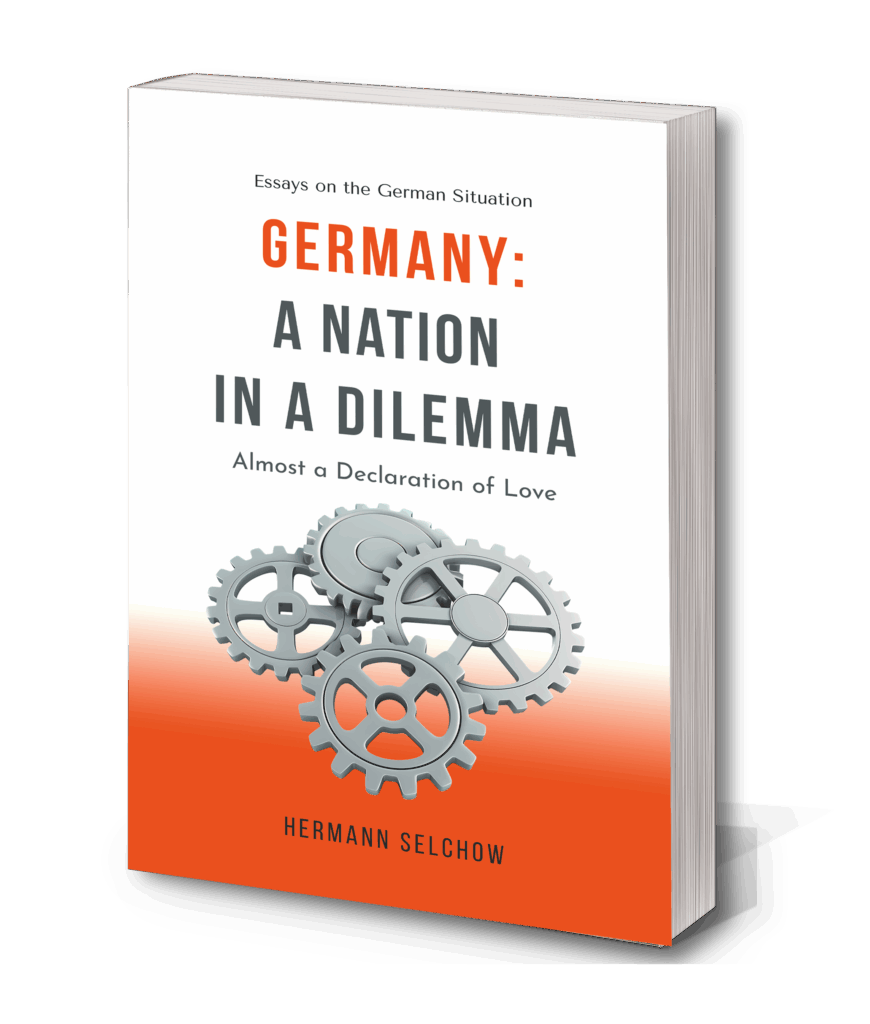
„Deutschland – Eine Nation im Dilemma – Beinahe eine Liebeserklärung“
Deutschland ist ein Land, das seine Neurosen wie Staatsauszeichnungen trägt. Ein Volk von Selbstzerstörern, die ihre Niederlagen kultivieren und dabei vergessen haben zu leben.
Diese provokanten Essays analysieren mit chirurgischer Präzision die deutsche Seele – jene merkwürdige Mischung aus Perfektionswahn und Selbsthass, aus historischer Obsession und gegenwärtiger Lähmung. Warum sabotieren Deutsche ihre eigenen Erfolge? Warum machen sie aus Vergangenheitsbewältigung eine Lebensphilosophie? Und warum ist ihre Gründlichkeit nur getarnte Selbstqual?
Mit der Schärfe eines Pathologen und der Zärtlichkeit eines Liebhabers seziert der Autor, der selbst Teil dieses Volkes ist, die Mechanismen deutscher Selbstzerfleischung, manchmal überspitzt, aber immer nahe an der Wahrheit. Das Ergebnis ist eine bitterböse Liebeserklärung an ein Land, das seine Selbstzerstörung zur Kunst erhoben hat.
Ein Buch über die deutschen Abgründe – und die seltsame Schönheit, die in ihnen liegt.
Ein Auszug:
Es gibt Völker, die ihre Geschichte wie einen Mantel tragen, würdevoll und selbstverständlich. Und es gibt solche, die sie wie einen Mühlstein um den Hals schleppen, stöhnend unter dem Gewicht vergangener Epochen. Die Deutschen gehören zweifellos zur zweiten Kategorie, wobei sie die bemerkenswerte Eigenschaft entwickelt haben, aus diesem Mühlstein noch zusätzliche Steine zu meißeln, um sich das Leben noch schwerer zu machen. Man könnte dies als eine besondere Form der Kreativität betrachten, wäre es nicht so tragisch produktiv in seiner Destruktivität.
Die vorliegende Untersuchung unternimmt den Versuch, diesem eigentümlichen Phänomen auf den Grund zu gehen, wobei der Autor, der selbst ein Teil dieses Volkes ist, sich bewusst ist, dass er damit ein Terrain betritt, das von Minenfeldern ideologischer und persönlicher Befindlichkeiten durchzogen ist. Doch was wäre die deutsche Seele ohne ihre Abgründe, was wäre der deutsche Geist ohne seine Selbstquälerei? Es ist, als hätte Goethe seinen Faust nicht als Warnung, sondern als Gebrauchsanweisung für ein ganzes Volk geschrieben. Der Pakt mit dem Bösen wurde längst geschlossen, nur dass Mephistopheles inzwischen die Gestalt des kollektiven Über-Ichs angenommen hat, das unermüdlich flüstert: Du bist nicht gut genug, du warst nie gut genug, du wirst nie gut genug sein
In der Tat scheint es, als hätten die Deutschen eine Art nationale Neurose entwickelt, die sich in periodischen Anfällen von Selbsthass und Selbstzerstörung äußert. Dabei ist bemerkenswert, mit welcher Gründlichkeit und Systematik dieses Volk an seiner eigenen Demontage arbeitet. Andere Nationen mögen ihre dunklen Kapitel haben, aber sie verstehen es, diese in den Kellergewölben der Erinnerung zu verwahren und darüber ein neues Stockwerk zu errichten. Die Deutschen hingegen haben aus ihren Kellern einen Schrein gemacht, vor dem sie täglich niederknien und Buße tun für Sünden, die längst zu Staub zerfallen sind, während sie gleichzeitig neue Sünden begehen im Namen der Läuterung.
Es ist ein Paradox von geradezu dialektischer Schönheit: Ein Volk, das sich selbst als das der Dichter und Denker versteht, hat es fertiggebracht, das Denken zu einem Instrument der Selbstkasteiung zu pervertieren. Wo einst Kant das sapere aude proklamierte, herrscht heute ein sapere nolo – ein entschiedenes Nichtwissenwollen, wenn es um die eigenen Stärken geht, kombiniert mit einer obsessiven Fixierung auf die eigenen Schwächen. Es ist, als hätte man Nietzsches Übermenschen durch seinen Gegenentwurf ersetzt: den deutschen Untermenschen, der in der Selbstverachtung seine höchste Vollendung findet.
Diese Selbstzerstörung vollzieht sich nicht in den großen Gesten des heroischen Untergangs, wie sie die Romantik einst verherrlichte. Sie ist subtiler, perfider, bürokratischer. Sie geschieht in Kommissionen und Arbeitsgruppen, in Studien und Expertisen, in einer endlosen Kette von Selbstbezichtigungen und Selbstverbesserungsversprechen. Die Deutschen haben das industrielle Verfahren auf die Seelenmassage angewendet und dabei eine Effizienz entwickelt, die ihre berühmten Ingenieure vor Neid erblassen ließe. Wenn Selbstzerstörung eine Olympische Disziplin wäre, hätten die Deutschen alle Medaillen abgeräumt und würden anschließend eine Kommission einsetzen, um zu untersuchen, ob ihr Sieg nicht vielleicht unfair war.
Dabei ist es nicht so, als mangelte es diesem Volk an Grund zum Selbstbewusstsein. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Deutschen eine der stabilsten Demokratien der Welt aufgebaut, eine Wirtschaftsmacht geschaffen, die ihresgleichen sucht, eine Kultur hervorgebracht, die von Bach bis Beuys reicht. Aber all das wird überlagert von einem seltsamen Bedürfnis, das Erreichte kleinzureden, zu relativieren, in Frage zu stellen. Es ist, als würde ein Tennisstar nach jedem Sieg sofort eine Pressekonferenz abhalten, um zu erklären, warum er eigentlich hätte verlieren müssen.
Dieses Phänomen ist nicht auf eine bestimmte politische Richtung beschränkt. Es durchzieht alle Schichten der Gesellschaft, alle Parteien, alle Institutionen. Rechts wie links, oben wie unten, überall findet man diese eigentümliche Mischung aus Größenwahn und Selbsthass, die so typisch deutsch ist. Die Rechten träumen von einem Zurück-wohin-auch-immer. Die Linken wollen die Welt retten und glauben nicht daran, dass Deutschland dazu in der Lage wäre. Die Mitte schwankt zwischen beiden Extremen und nennt das ausgewogene Politik.
Man könnte vermuten, dass dieses Verhalten eine Folge der historischen Traumata des 20. Jahrhunderts ist, und zweifellos spielen diese eine Rolle. Aber das erklärt nicht, warum andere Nationen mit ähnlich belasteten Geschichten einen anderen Weg gefunden haben. Die Japaner haben Hiroshima und Nagasaki hinter sich gelassen und sind zu einer Kulturnation geworden. Die Spanier haben Franco überwunden und sich zu einer modernen Demokratie entwickelt. Die Deutschen hingegen scheinen ihre Vergangenheit wie eine chronische Krankheit zu kultivieren, die zwar nicht tödlich ist, aber das Leben zur Qual macht.
Vielleicht liegt das Problem tiefer, in der deutschen Seele selbst, die seit Jahrhunderten zwischen Extremen hin- und herpendelt. Entweder Heiliges Römisches Reich oder Kleinstaaterei, entweder Sturm und Drang oder Biedermeier, entweder Größenwahn oder Selbstverachtung. Es scheint, als hätten die Deutschen nie gelernt, die Mitte zu finden, das Maß zu halten. Sie sind ein Volk der Superlative, auch im Negativen. Wenn sie sich schon selbst zerstören, dann wenigstens gründlich.
Diese Gründlichkeit zeigt sich besonders in der Art, wie die Deutschen mit ihrer eigenen Identität umgehen. Andere Völker haben eine Identität, die Deutschen haben ein Identitätsproblem. Sie sezieren ihre Nationalität mit der gleichen Intensität, mit der sie ihre Autos konstruieren, und kommen dabei zu dem Schluss, dass sie eigentlich keine Nation sein dürften. Es ist ein Teufelskreis: Je mehr sie über sich nachdenken, desto weniger gefällt ihnen, was sie sehen. Je weniger ihnen gefällt, desto mehr denken sie nach. Am Ende steht ein Volk, das sich selbst zum Objekt seiner eigenen Forschung gemacht hat und dabei vergessen hat zu leben.
Betrachten wir etwa die deutsche Sprache, diese herrliche, komplexe, präzise Sprache, die Goethe und Schiller, Heine und Brecht hervorgebracht hat. Was machen die Deutschen daraus? Sie verunstalten sie mit Anglizismen, verstümmeln sie mit Gendersternchen, verwässern sie mit politischer Korrektheit. Es ist, als würde man eine Stradivari nehmen und sie als Brennholz verwenden. Die Sprache, die einst die Sprache der Philosophie und der Dichtung war, wird zu einem Instrument der Selbstunterwerfung.
Oder nehmen wir die deutsche Industrie, einst der Stolz der Nation, Symbol für Qualität und Innovation. Was geschieht mit ihr? Sie wird demontiert im Namen des moralischen Fortschritts, verlagert im Namen der Globalisierung, reguliert im Namen des Umweltschutzes. Natürlich sind Umweltschutz und Globalisierung wichtige Themen, aber nur die Deutschen schaffen es, aus jeder Herausforderung eine Gelegenheit zur Selbstaufgabe zu machen. Andere Nationen nutzen den Wandel als Chance, die Deutschen als Buße.
Diese Tendenz zur Selbstkasteiung zeigt sich auch in der deutschen Außenpolitik. Während andere Länder ihre Interessen verfolgen und das auch offen sagen, sprechen deutsche Politiker von „Verantwortung“ und meinen damit meist Verzicht. Deutschland soll zahlen, Deutschland soll helfen, Deutschland soll sich zurücknehmen. Immer sind es die anderen, die Rechte haben, Deutschland hat nur Pflichten. Es ist eine merkwürdige Form des Imperialismus: der Imperialismus der Selbstverleugnung.
Man fragt sich, ob dieser Masochismus nicht auch eine Form von Narzissmus ist. Wer sich so intensiv mit seiner eigenen Schlechtigkeit beschäftigt, macht sich immer noch zum Mittelpunkt des Universums. Die deutsche Schuld wird zu einer neuen Form der deutschen Größe: Wir sind die Schlechtesten, also sind wir auch die Wichtigsten. Es ist eine perverse Logik, aber eine, die funktioniert. Deutschland mag seine Wirtschaftsmacht verlieren, seine kulturelle Ausstrahlung, seinen politischen Einfluss – seine moralische Selbstgeißelung macht es immer noch einzigartig.
Dabei übersehen die Deutschen, dass ihre permanente Selbstkritik längst zu einer neuen Form der Arroganz geworden ist. Wer ständig betont, wie schlecht er ist, erwartet Bewunderung für seine Ehrlichkeit. Wer sich permanent entschuldigt, macht deutlich, dass er sich für wichtig genug hält, um entschuldigt zu werden. Die deutsche Demut ist eine Tarnung für deutschen Hochmut, die deutsche Bescheidenheit eine Maske für deutsche Überheblichkeit.
Es ist bezeichnend, dass diese Selbstzerstörung immer im Namen höherer Werte geschieht. Die Deutschen zerstören sich nicht aus Lust an der Zerstörung, sondern aus Liebe zur Moral. Sie opfern ihre Interessen nicht dem Egoismus, sondern dem Altruismus. Sie schwächen sich nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke. Es ist die reinste Form der Perversion: das Böse im Namen des Guten zu tun.
Betrachten wir die deutsche Geschichtspolitik. Kein anderes Volk beschäftigt sich so intensiv mit seiner Vergangenheit, kein anderes hat so viele Gedenkstätten, Denkmäler, Erinnerungsrituale. Das ist an sich ehrenwert, aber die Deutschen haben daraus eine Industrie gemacht, einen Kult, eine Religion. Die Vergangenheit wird nicht bewältigt, sondern zelebriert. Nicht im Sinne einer Verherrlichung, sondern im Sinne einer ewigen Selbstanklage. Es ist, als hätten die Deutschen beschlossen, ihre Geschichte nicht zu überwinden, sondern sie zu ihrem Schicksal zu machen.
Diese obsessive Beschäftigung mit der Vergangenheit hat zur Folge, dass die Gegenwart aus dem Blick gerät. Während die Deutschen die Verbrechen von vor achtzig Jahren erforschen, übersehen sie die Probleme von heute. Während sie sich für die Sünden ihrer Großväter entschuldigen, ignorieren sie die Herausforderungen ihrer Kinder. Es ist eine Form der historischen Flucht: Man beschäftigt sich mit der Vergangenheit, um nicht über die Zukunft nachdenken zu müssen.
Dabei ist es paradox: Je mehr sich die Deutschen mit ihrer Geschichte beschäftigen, desto weniger lernen sie aus ihr. Die Lehre aus der Vergangenheit sollte sein, dass Extremismus gefährlich ist. Stattdessen haben die Deutschen den Extremismus nur verlagert: vom politischen ins moralische. Sie sind nicht mehr extrem nationalistisch, sondern extrem selbstkritisch. Sie sind nicht mehr extrem stolz auf ihr Land, sondern extrem beschämt über es. Das Pendel schlägt in die andere Richtung aus, aber es bleibt ein Extremismus.
Diese Extreme zeigen sich auch in der deutschen Mentalität des Alles-oder-Nichts. Die Deutschen können nicht einfach nur ein bisschen umweltbewusst sein, sie müssen die Welt retten. Sie können nicht einfach nur tolerant sein, sie müssen die Toleranz erfinden. Sie können nicht einfach nur demokratisch sein, sie müssen die beste Demokratie der Welt haben. Und wenn sie merken, dass sie nicht perfekt sind, dann sind sie sofort die Schlechtesten. Es gibt keine Zwischentöne, keine Grautöne, nur Schwarz oder Weiß.
Diese Schwarz-Weiß-Mentalität durchzieht alle Bereiche des deutschen Lebens. In der Wirtschaft gibt es nur Wachstum oder Krise, in der Politik nur Fortschritt oder Reaktion, in der Kultur nur Avantgarde oder Spießertum. Die Deutschen haben verlernt, dass das Leben hauptsächlich aus Grautönen besteht, aus Kompromissen, aus unvollkommenen Lösungen für komplizierte Probleme. Sie wollen immer das Absolute, das Reine, das Vollkommene. Und da es das nicht gibt, zerbrechen sie daran.
Vielleicht ist das der Kern des deutschen Problems: die Unfähigkeit zur Ironie. Andere Völker können über sich selbst lachen, können ihre eigenen Schwächen mit Humor betrachten, können Widersprüche aushalten, ohne daran zu zerbrechen. Die Deutschen nehmen sich und alles andere bittererst. Sie können nicht lachen über ihre eigenen Marotten, ihre eigenen Eigenarten, ihre eigenen Widersprüche. Alles muss Bedeutung haben, alles muss wichtig sein, alles muss ernst genommen werden.
Diese Humorlosigkeit ist vielleicht die verheerendste Form der deutschen Selbstzerstörung. Wer jeden Fehler als Katastrophe betrachtet, wird handlungsunfähig. Wer jede Kritik als vernichtend empfindet, wird zum Neurotiker. Die Deutschen haben aus ihrer Geschichte den falschen Schluss gezogen: Nicht dass man Fehler vermeiden muss, sondern dass man keine machen darf. Und da Fehler menschlich sind, bedeutet das letztendlich, dass man nicht menschlich sein darf.
Betrachten wir die deutsche Bürokratie, diese perfekte Metapher für den deutschen Geist. Ursprünglich geschaffen, um Ordnung zu schaffen, hat sie sich zu einem Selbstzweck entwickelt. Regeln werden nicht mehr erlassen, um Probleme zu lösen, sondern um Regeln zu haben. Verfahren werden nicht mehr angewendet, um Ziele zu erreichen, sondern um Verfahren anzuwenden. Die Form hat den Inhalt verschlungen, die Mittel sind zum Zweck geworden. Es ist die Bürokratisierung des Lebens, die Verrechtlichung der Existenz, die Regulierung der Seele.
Und überall in dieser Bürokratie findet man das gleiche Muster: die Lust an der Selbstbeschränkung, die Freude am Verzicht, das Vergnügen am Verbot. Es ist, als hätten die Deutschen entdeckt, dass man Macht auch dadurch ausüben kann, dass man sie nicht ausübt. Wer sich selbst die strengsten Regeln auferlegt, kann sich moralisch überlegen fühlen. Wer am meisten verzichtet, gewinnt. Es ist eine perverse Form des Wettbewerbs: Wer kann sich am meisten selbst schaden?
Diese Logik durchzieht auch die deutsche Wirtschaftspolitik. Während andere Länder versuchen, ihre Wirtschaft zu stärken, versucht Deutschland, seine Wirtschaft zu zivilisieren. Gewinn ist verdächtig, Erfolg ist peinlich, Wettbewerb ist unfair. Stattdessen soll die Wirtschaft dienen: der Umwelt, der Gesellschaft, der Moral. Das ist an sich nicht verkehrt, aber die Deutschen übertreiben auch hier. Sie wollen nicht nur eine erfolgreiche Wirtschaft, sondern eine moralische Wirtschaft. Und da Moral und Erfolg oft in Konflikt stehen, wählen sie die Moral und wundern sich über den ausbleibenden Erfolg.
Es ist bezeichnend, dass Deutschland in vielen Zukunftstechnologien den Anschluss verloren hat. Nicht weil es an technischen Fähigkeiten mangelte, sondern weil man sich zu viele Gedanken über die moralischen Implikationen gemacht hat. Während andere Länder Atomkraft genutzt haben, hat Deutschland sie verteufelt. Während andere Gentechnik entwickelt haben, hat Deutschland sie reguliert. Während andere künstliche Intelligenz vorangetrieben haben, hat Deutschland über die Ethik diskutiert. Am Ende haben die anderen die Technologie und Deutschland die Ethik. Aber Ethik ohne Macht ist folgenlos, Moral ohne Mittel ist wirkungslos.
…