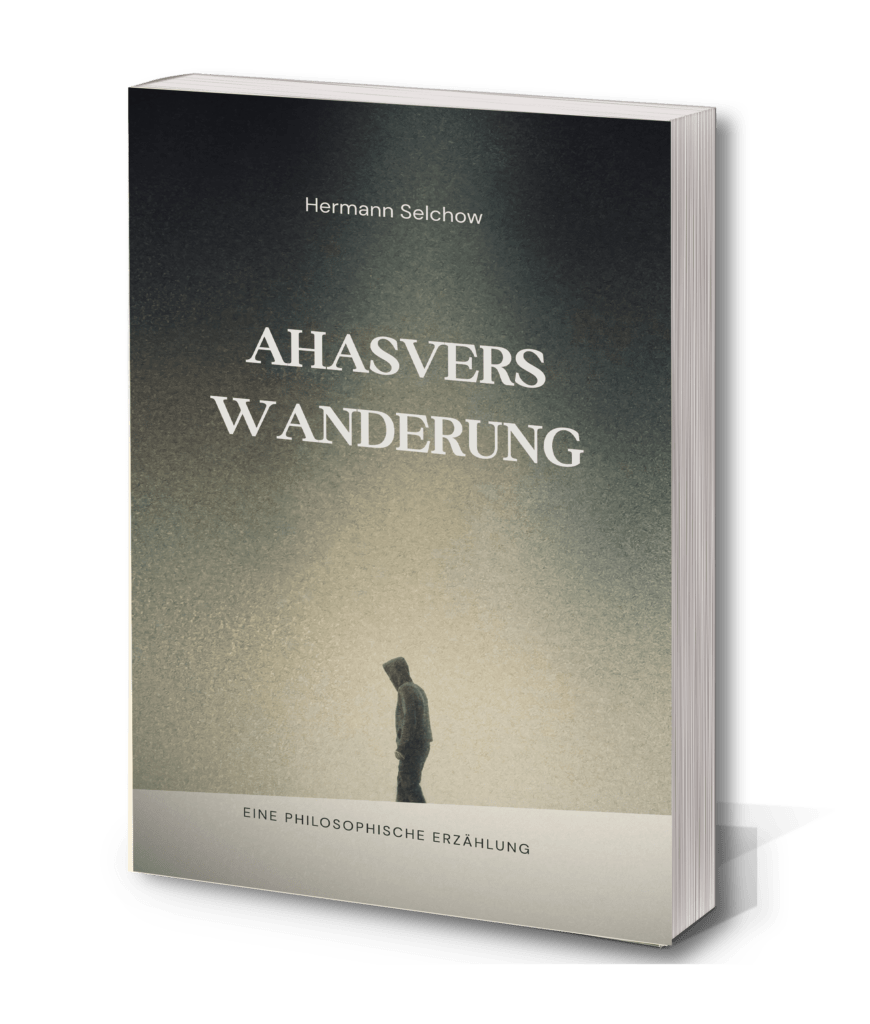
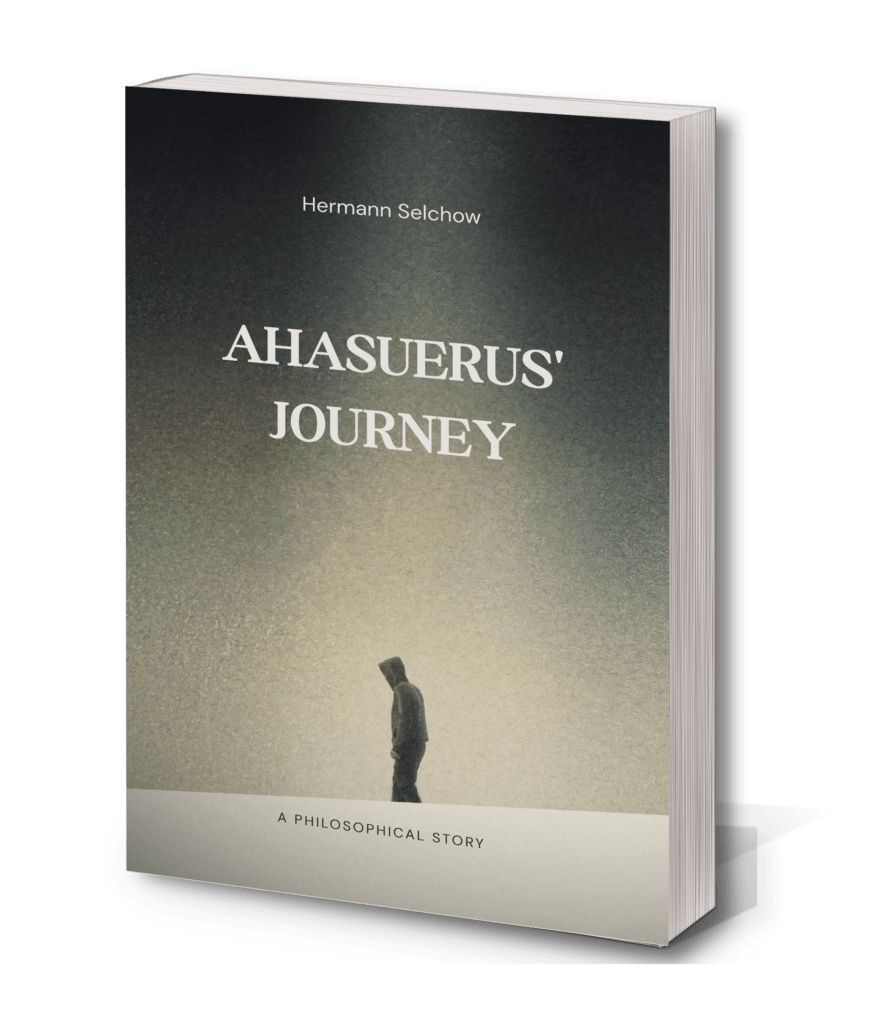
Mit „Ahasvers Wanderung“ legt der Autor Hermann Selchow, der bereits für seine philosophischen Texte bekannt ist, einen Roman vor, der eine alte Legende in eine vielschichtige, zeitübergreifende Erzählung verwandelt. Ausgangspunkt ist Jerusalem zur Zeit der römischen Besatzung: Ahasver, ein Schuster, hält an Regeln fest, weil sie ihm Sicherheit geben. In einem entscheidenden Moment verweigert er einem Verurteilten einen Schluck Wasser und wird mit einem Satz in ein Schicksal gestoßen, das ihn nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Von da an ist er gezwungen, weiterzugehen: durch Orte, Zeiten und Ideologien, die sich ändern, während die Grundfragen menschlichen Handelns erstaunlich gleich bleiben.
Der Roman entfaltet sich als Folge eindringlicher Stationen, in denen Ahasver erlebt, wie sich das Versprechen von Ordnung in Fanatismus verwandeln kann, wie Fortschritt zugleich Hoffnung und Entmenschlichung bedeutet, und wie Sprache, Bilder und Deutungen Menschen lenken. Selchow verbindet historische Schauplätze mit philosophischer Präzision und zeichnet eine Figur, die nicht als Held inszeniert wird, sondern als Zeuge – oft überfordert, manchmal hart, immer wieder gezwungen, sich dem eigenen Anteil zu stellen. So entsteht ein literarischer Text, der weniger über spektakuläre Wendungen als über moralische Reibung wirkt: über Angst als Triebkraft, über Zugehörigkeit und Ausgrenzung, über Schuld und Verantwortung und über jene kleinen Entscheidungen, in denen sich Menschlichkeit zeigt oder eben nicht.
Das Werk kontrastiert die Sehnsucht nach Sicherheit und Gesetz mit der zerstörerischen Kraft von Ideologien, die Menschen in starre Systeme pressen. Ahasver erkennt dabei, dass wahrer Fortschritt nicht in technischen Mitteln oder moralischen Dogmen liegt, sondern in der unmittelbaren Verantwortung gegenüber dem Nächsten. Am Ende wandelt sich sein Fluch der Ewigkeit in eine existenzielle Aufgabe: Er akzeptiert das lebenslange Unterwegssein als Chance, der Versuchung des Wegsehens zu widerstehen. Die Erzählung ist somit eine tiefgründige Reflexion über Angst, Macht und die Zerbrechlichkeit menschlicher Freiheit.
Ein Auszug:
Staub ist das Gedächtnis einer Menge. Er legt sich auf Wimpern, auf Zungen, in die Falten der Kleidung, und später, wenn alles vorbei ist, findet man ihn wieder in den Falten der eigenen Hände, als hätte man das Geschehen selbst geformt.
Die Gasse vor meiner Werkstatt leerte sich langsam, aber nicht ordentlich. Menschen lösten sich nicht auf wie Rauch, sie blieben in kleinen Gruppen stehen, redeten, deuteten, wiederholten Sätze, die sie selbst nicht verstanden. Einige schauten noch einmal zu meiner Tür, als sei dort etwas geschehen, das man bewerten müsse. Ein Mann spuckte auf den Stein, halb aus Ekel, halb aus Erleichterung. Eine Frau zog ihr Kind näher zu sich, so, als könnte sie es vor Blicken schützen.
Die Werkstatt hielt den Atem an. Werkzeug lag still, Leder roch nach Arbeit, Pech glänzte in der Schale wie eine dunkle, geduldige Flüssigkeit. Aber etwas war verschoben. Nicht sichtbar, eher wie ein Nagel, den jemand ein wenig gelockert hat, so wenig, dass das Brett noch hält, aber genug, dass es irgendwann knarren wird.
Der Satz in meinem Kopf blieb: Du fürchtest, dass alles zerbricht.
Draußen bewegte sich die Stadt weiter, als wäre nichts, und genau das war das Unheimliche. Ordnung kann so tun, als habe sie gesiegt, während sie schon Risse hat.
Der Schritt vor die Tür geschah nicht als Entscheidung, sondern als Reaktion, wie ein Körper auf Rauch reagiert. Die Gasse war heller als die Werkstatt, der Staub stand in der Sonne, tanzte, als sei dies ein Fest. Der Lärm war weitergezogen, aber er war nicht weg. Er hing noch zwischen den Häusern, in den Stimmen, die nachklangen. Er zog Richtung Stadtrand, dorthin, wo man Dinge beendet, die man nicht mehr in der Mitte haben will.
Die Füße trugen mich. Nicht schnell, nicht eilig, eher mit einem unangenehmen Nachdruck, als müsse etwas kontrolliert werden. Vielleicht die Römer. Vielleicht die Menge. Vielleicht die eigene Hand, ob sie wirklich am Türpfosten geblieben war.
Weiter vorn, wo die Straße breiter wurde, gab es wieder diese Bewegung, dieses Ziehen. Noch einmal drängten Körper, noch einmal standen Köpfe dicht. Ein paar Händler hatten ihre Stände halbherzig geöffnet, als könne man den Tag mit Feigen und Öl überleben.
Dann war er wieder zu sehen. Nicht mehr so nah wie vor meiner Tür, aber nah genug, um die Schwere zu spüren, die er mit sich trug. Das Holz auf seinem Rücken wirkte nicht wie ein Gegenstand, es wirkte wie ein Urteil, das man anfassen kann. Die Römer gingen nebenher wie Männer, die eine Arbeit erledigen, die ihnen nicht einmal mehr Vergnügen macht.
Die Menge hatte unterschiedliche Gesichter: Schaulust, Mitgefühl, Hass, Erregung. Eine Stadt als Spiegel, aber zerkratzt, sodass man nichts klar erkennt.
Am Rand stand ein alter Mann und murmelte Gebete, nicht laut genug, um jemandem zu widersprechen, nur laut genug, um sich seiner selbst zu vergewissern. Ein Junge hob einen Stein auf und ließ ihn wieder fallen, als wüsste er nicht, welche Rolle ihm zusteht.
Das war nicht mein Platz hier. Das sagte der Kopf. Das sagte der Teil, der sich seit Jahren an Grenzen festhält wie an einem Geländer. Der Körper blieb trotzdem.
Und plötzlich, als hätte die Masse ein einziges Mal geatmet und dabei kurz vergessen, sich zu bewegen, kam es zu einer Lücke. Kein großer Moment. Keine Bühne. Nur ein winziger Spalt zwischen Schultern, in dem ein Blick passieren konnte.
Seine Augen fanden mich.
Nicht suchend. Nicht zufällig. Als hätten sie mich schon die ganze Zeit gesehen, auch als ich noch neben Türholz stand.
Eine Kälte lief mir über den Rücken, als hätte mir jemand eine Hand in den Nacken gelegt. Nicht hart. Nicht bedrohend. Eher wie eine Markierung: Dich.
Der Mund öffnete sich, und die Stimme, die herauskam, war kaum Stimme. Trotzdem schnitt sie durch das Gemurmel, als würde sie nicht durch Luft gehen, sondern durch etwas Tieferes.
„Du“, sagte er.
Das war alles. Ein einziges Wort. Kein Name. Kein Fluch. Und doch spürte es sich an, als hätte jemand meinen Namen in die Welt geritzt.
Der Kopf wollte sich abwenden, die Augen wollten ausweichen, so wie man es tut, wenn man einem Römer nicht zu lange ins Gesicht schaut. Aber da war kein römischer Blick. Da war etwas Anderes: ein Blick, der nicht nimmt, sondern sieht.
„Geh weiter“, presste ich hervor, und die Stimme klang mir fremd. Schärfer als nötig. Lauter als klug.
„Du hast mich fortgeschickt“, sagte er, und im Satz lag keine Beschwerde. Eher ein Festhalten an einer Tatsache, die nun zwischen uns stand wie ein Gegenstand.
„Du bringst Unordnung“, antwortete es aus mir heraus, schneller als der Verstand reagieren konnte. „Unruhe. Worte, denen die Leute hinterherlaufen. Ich brauche das nicht vor meiner Tür.“
Ein römischer Offizier rief etwas, die Speere hoben sich, ein paar Menschen wichen zurück. Ein Kind schrie kurz auf, dann war nur noch das schwere Atmen vieler Körper zu hören.
Seine Lippen bewegten sich langsam, als koste jedes Wort Kraft.
„Du brauchst Ordnung“, sagte er.
Das traf wie ein Stein auf Glas. Ordnung war das, was mich hielt. Ordnung war mein Rechtfertigungsgrund. Ordnung war nicht etwas, das ein geschlagener Mann einfach benennen darf, als hätte er es begriffen.
„Ja“, sagte ich. „Ordnung. Gottes Gesetz. Und die Römer halten die Stadt in Grenzen. Ohne Grenzen…“
„…zerfällt alles“, beendete er den Satz für mich.
Die Menge machte ein Geräusch, klein, verwundert, als hätte jemand etwas ausgesprochen, das man sonst nur denkt. Aus dem Rand hörte man ein spöttisches Lachen, aber es blieb hängen, als traue es sich nicht, ganz zu werden.
Sein Blick blieb an mir, ruhig, unverschämt ruhig, mitten in diesem Dreck, mitten im Blut. Und plötzlich war da, für einen Atemzug, nicht die Menge, nicht die Römer, nicht einmal das Kreuz. Nur diese Ruhe, die so gar nicht passte, die wie ein Riss im Tag war.
„Du hältst dich an Gesetze“, sagte er. „Aber du hast dich nicht an das gehalten, was sie schützen sollen.“
Der Satz war leise. Und genau deshalb war er unerträglich. Nicht, weil er beleidigte, sondern weil er die Möglichkeit in die Luft stellte, dass meine Ordnung nicht Schutz ist, sondern Angst in sauberer Kleidung.
„Du bist nicht in der Lage, mich zu belehren“, sagte ich, und ich hörte, wie ich mich selbst rettete, indem ich ihn klein machte. „Du bist verurteilt. Das Urteil ist gesprochen.“
Ein Soldat stieß ihn wieder, ungeduldig. Die Dornen ruckten, ein dünner Blutstreifen zog sich über die Schläfe, als würde die Haut den Kopf nicht mehr halten können. Seine Knie knickten kurz ein, dann stand er wieder. Nicht stolz, einfach, weil er noch stand.
„Das Urteil“, murmelte er, „wird dich finden.“
Und dann, als würde die Stadt um uns herum für den Bruchteil eines Augenblicks den Atem vergessen, richtete sich der Blick, und die Stimme gewann eine Klarheit, die nicht aus menschlicher Kraft kam.
„Du wirst gehen“, sagte er.
…